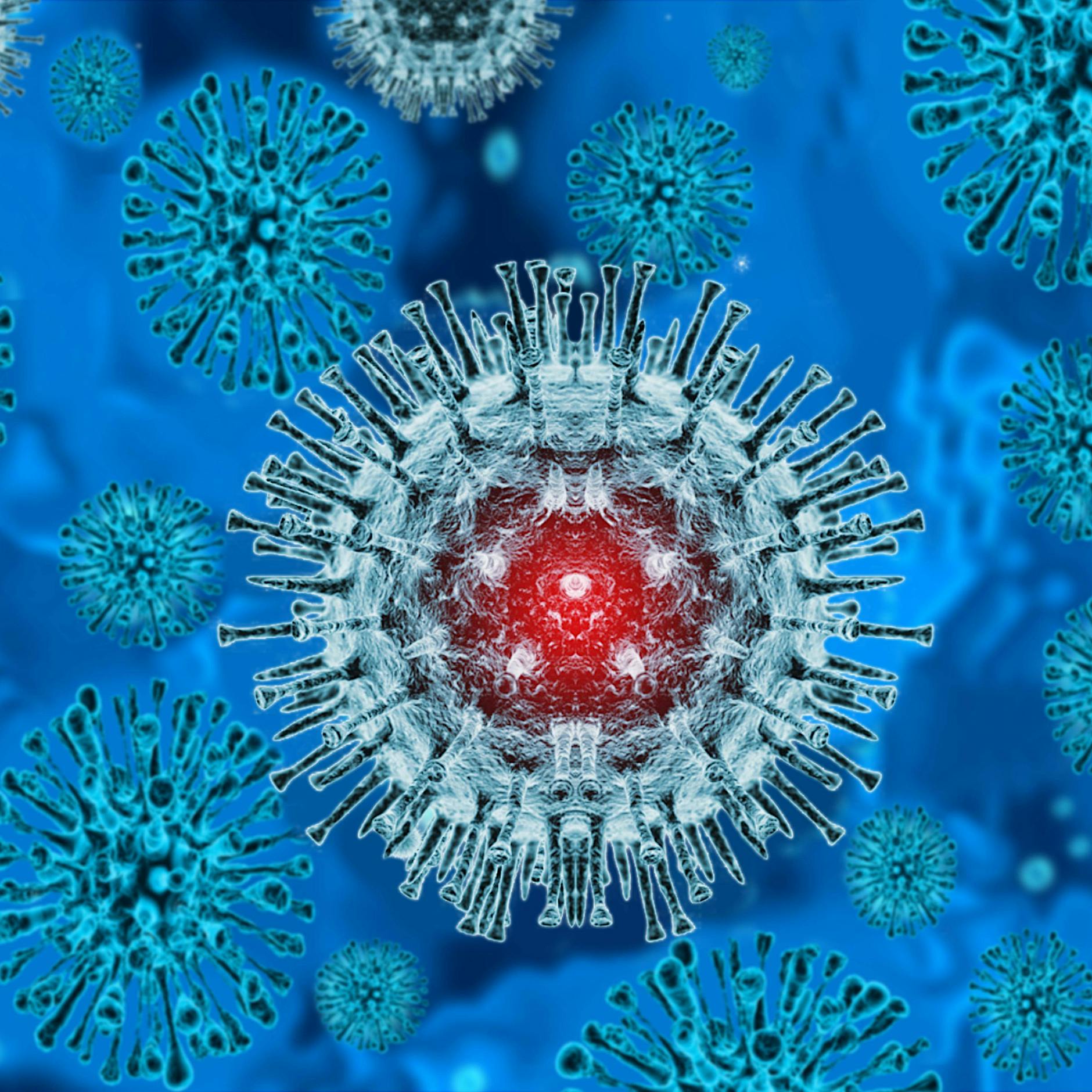Fehrbelliner Platz, mehr West-Berlin geht kaum. Wir treffen Klaus Wowereit im Parkcafè am bislang einzigen verregneten Vormittag im Juli. Der 68-Jährige kommt püntklich auf die Minute, ist sportlich-leger gekleidet, braungebrannt und gut aufgelegt. Das Gespräch beginnt direkt, ohne lange Anlaufzeit – der Regierende Bürgermeister a. D. ist ganz Profi geblieben, bleibt keine Antwort schuldig und ist gewohnt charmant.
Herr Wowereit, Sie sind seit acht Jahren nicht mehr im Amt. Wie verbringt ein Bürgermeister a.D. seine Tage?
Meine Tage unterscheiden sich nicht wesentlich von denen anderer Rentner (lacht). Ich habe natürlich mehr Zeit und weniger Aufgaben als früher, denn ich habe es von Beginn an vermieden, all die Ehrenämter, Kuratorien und Vereinsvorsitze zu übernehmen, die man mir angeboten hat, nur um etwas zu tun zu haben. Es gibt ein paar Sachen, die ich mache und die mir sehr am Herzen liegen wie beispielsweise meine ehrenamtliche Arbeit für die Berliner Aids-Hilfe, aber ich habe auch eine Menge Angebote auf Distanz gehalten.
Einfach, weil Sie nicht mehr konnten?
Wenn man aufhört, dann sollte man auch konsequent sein und schon gar nicht auf die Idee verfallen, sich ins Tagesgeschäft anderer Leute einzumischen. Das fällt vielen Menschen bekanntlich sehr schwer und das hat mich schon geärgert, als ich noch aktiv war. Diese gutgemeinten Ratschläge und wohlwollenden Seitenhiebe von den Vorgängern – da geht es zumeist nur darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Das brauche ich nicht, das hatte ich dreizehn Jahre lang zur Genüge.
Klassische Frage: Kam nach dem Amtsende das Loch, in das man fällt?
Meistgelesene Artikel
Eigentlich nicht. Ich wusste zwar vorher auch nicht, wie das sein wird, aber ich habe mich darauf gefreut, mal wieder selbstbestimmt zu sein und Zeit mit mir und vor allen Dingen mit meinem Partner zu verbringen.
Sie haben in der Pandemie Ihren Partner Jörn Kubicki verloren, mit dem Sie 27 Jahre zusammen waren. Eine große Zäsur. Hat sich Ihr Leben seitdem wieder in ruhigeren, normaleren Bahnen bewegt?
Nein, mein Leben ist seitdem ein anderes und der Verlust wiegt immer noch schwer. Mir fehlt eben mein Partner, er ist nicht zu ersetzen und Sie können sich sicher sein, dass ich einen großen Bekannten- und Freundeskreis habe. Ich beschwere mich aber nicht, denn das ist ja nicht nur ein Schicksal, das Klaus Wowereit hat. Damit muss man, damit muss ich zurechtkommen. Aber schwer ist es auf jeden Fall.
Fehlt Ihnen das Rampenlicht?
Klar, mit der Aufgabe des Amtes ist auch ein Bedeutungsverlust verbunden. Wenn ich früher zu einer Veranstaltung gegangen bin, dann wurde das vorher von meinem Büro organsiert und dann kam man da mit einer Entourage an und der Pressereferent wartete schon vor Ort, Herr Wowereit hier, Herr Wowereit da, und so weiter. Die Leute wollen auch immer was von einem Bürgermeister und versprechen sich etwas, da bekommt man natürlich sehr viel Aufmerksamkeit und wird auch umschwärmt. Das endet schlagartig, das ist systemimmanent und damit muss man umgehen können. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das vermissen. Und mit Corona kam dann auch wirklich alles zum Erliegen. Jetzt kommen die Einladungen aber so langsam wieder, heute Abend gehe ich zum Beispiel zum Produzentenfest ins Tipi am Kanzleramt. Ich kann, aber ich muss nicht, das ist das Schöne daran.

Zwei Aussprüche sind geblieben, mit denen Sie Geschichte geschrieben haben. Der eine ist „Berlin ist arm, aber sexy“ und der andere „Ich bin schwul, und das ist auch gut so“. Hat Sie das öffentliche Coming-out damals viel Überwindung gekostet?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ich gehöre einer Generation an, die ihre Neigung nicht etikettiert hat, und bis ich Regierender Bürgermeister wurde, war ich auch der Überzeugung, das sei meine Privatsache. Das war sicherlich auch eine Art Selbstschutz. Aber die Journalisten wussten es ohnehin alle, ich bin ja mit meinem Partner Jörn Kubicki öffentlich aufgetreten. Da musste man schon sehr ignorant sein, um das nicht zu bemerken. Hätte man mir aber zwei, drei Jahre vorher erzählt, dass ich mal auf einem Parteitag mein Outing haben würde, dann hätte ich das sicherlich nicht sofort bejaht.
Wollten Sie mit dem Outing anderen Parteien und der Boulevardpresse vorweggreifen?
So konkret habe ich das nicht gesehen und ich hatte das bei einer Fraktionssitzung hinter verschlossenen Türen ja auch schon mal gesagt. Aber was bleibt da schon geheim? Ich wollte reinen Tisch machen, damit es nicht nachher heißt, man hätte besser die Finger von mir gelassen, wenn man das im Vorfeld schon gewusst hätte. Die gängige Haltung gegenüber Homosexualität in Ämtern war damals auch getreu der Devise „Du darfst es sein, aber behalte es bitte für dich“. Das ist auch heute noch in manchen Bereichen wie dem Profifußball so. Thomas Hitzlsperger hat sich auch erst nach seinem Karriereende geoutet und mir mal erzählt, dass man ihm dringend abgeraten hatte, das in seiner Zeit als aktiver Fußballer zu tun. Wenn man bedenkt, dass im Jugendfußball noch immer „Du schwule Sau“ in den Kabinen gehört wird, weiß man, dass es da noch viel zu tun gibt, dass noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Ich kann schon verstehen, dass man sich in einem solchen Umfeld nicht als schwuler Mann outen möchte.
Meinen Sie, es hätten Ihnen geschadet, wenn das später herausgekommen wäre?
Das kann ich nicht sagen, ich habe das sehr spontan und aus dem Bauch heraus gemacht. Mittwochs war die Koalition geplatzt, am Donnerstag war die Sitzung und am Sonntag der Parteitag, da war keine Zeit für große Analysen. Es gab aber in der Szene und der FAZ schon am Sonnabend Berichte darüber, das war am Sonntag also kein so großes Geheimnis mehr. Dann trat der Boulevard auf den Plan und versuchte, eine Schmuddelkampagne zu starten.
Wäre das heute anders?
Da bin ich mir sicher. In der Politik ist das Thema einigermaßen durch. Da kam dann auch Guido Westerwelle von der FDP, und später dann sogar die CDU mit dem Hamburger Bürgermeister Ole van Beust und dem späteren Gesundheitsminister Jens Spahn. Deren Outings haben nicht mehr so hohe Wellen geschlagen.
Haben Sie jemals Nachteile erfahren wegen Ihrer Homosexualität?
Das ist rückblickend schwer zu sagen, aber bei bestimmten missliebigen Entscheidungen kamen immer Schmähbriefe, später Mails, die mein Schwulsein dann zum Grund nahmen, mich zu beschimpfen. Ich habe auch regelmäßig die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, schon aus Prinzip. Bestimmt gab es auch Leute, die mich wegen meines Outings nicht mehr gewählt haben, aber die positiven Seiten haben in jedem Fall überwogen.
Sehen Sie sich als Wegbereiter der schwul-lesbischen Gleichberechtigung in Berlin?
Nicht nur in Berlin, das war mir am Anfang aber nicht bewusst. Ich habe sehr viele Reaktionen erhalten, auch von vielen Eltern, die mir Mut gemacht und sich bedankt haben nach dem Motto: „Wenn der Regierende Bürgermeister von Berlin schwul ist, dann kann ich auch zu meinem schwulen Sohn oder meiner lesbischen Tochter stehen.“ Und es kamen auch Briefe von Menschen, die mir schrieben, dass ich ihnen geholfen hätte, sich in ihrer Lebensmitte zu outen. Man hat das heute nicht mehr so präsent, aber das war damals Talk of the Town, zudem auf der Titelseite der New York Times. Das hat mich sehr gerührt und tut es bis heute. Die queere Szene Berlins hat mich dafür hinreichend gewürdigt und darauf bin ich stolz.
Sind Sie eigentlich froh, dass die AfD in Ihrer Regierungszeit noch nicht im Bundestag war?
Definitiv, aber Sie können sich sicher sein, dass ich da keiner Auseinandersetzung und keiner Diskussion aus dem Weg gegangen wäre. Aber da ich nicht in den sozialen Medien vertreten bin, bekomme ich vieles auch nicht mit. Mit anderen Worten: Ein Shitstorm würde mich nicht erreichen (lacht).
Sie sind in Tempelhof aufgewachsen, einem damals kleinbürgerlichen Stadtteil. Wie war das Leben als schwuler Mann in Ihrer Jugend?
Das hat sich nicht unterschieden von den Schicksalen anderer, da gab es wirklich nicht viel Besonderes, außer dass man in einer Großstadt wie Berlin auch schon damals einen Zugang zur Szene hatte. Provinzialität hängt auch nicht vom Ort ab, das ist eine Frage des Denkens. Ich hatte eine Art „Slow-Outing“, ich habe mein Schwulsein nicht versteckt, aber bin damit auch nicht hausieren gegangen. Es gab nicht diesen einen großen Moment, an dem alles aus mir herausbrach, das entspricht mir auch gar nicht.
Und wie war Ihr Coming-out im Elternhaus?
Ebenfalls langsam, man hat nicht wirklich darüber gesprochen, das diskutierte man damals nicht. Da ist aber viel geschehen, wenn man sich die Zeit seit meiner Jugend ansieht, es ist ja noch nicht so lange her, dass Homosexualität strafbar war. Bis zur Ehe für alle und dem Gleichstellungsgesetz ist eine Menge passiert in den letzten fünf Jahrzehnten, oft aber viel zu spät. Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile nicht nur eine große Toleranz, sondern auch eine Akzeptanz gibt gegenüber der queeren Community in all ihren Facetten. Gleichzeitig darf man sich nicht der Illusion hingeben, alles würde von Tag zu Tag besser. Maneo, das queere Antigewalt-Projekt, hat auch nicht weniger zu tun als früher. Man muss ohnehin gar nicht so weit in die Ferne blicken: Wenn in Ungarn oder Polen eine Pride-Parade durch die Städte zieht, weiß man ja immer schon, dass es auch zu Ausschreitungen seitens der Rechten kommen wird, zu Beleidigungen und Aggressionen bis hin zu körperlicher Gewalt. Und mit diesem Beispiel haben wir Europa noch nicht mal verlassen. Es gibt immer wieder Rückfälle, sehen Sie nur auf die Vereinigten Staaten – die Haltung des Supreme Courts ist ja ein Riesenschritt rückwärts, was die Selbstbestimmung von Frauen anbelangt.
Wie ist man Ihnen in den erwähnten und anderen Ländern mit restriktiven Haltungen gegenüber homo- und transsexuellen Menschen in Ihrer Amtszeit als offen schwuler Bürgermeister entgegengetreten?
Einige Staatsoberhäupter und Potentaten klammern bestimmte Themen einfach aus. Der König von Saudi-Arabien war im Roten Rathaus zu Gast und wir haben uns beim Mittagessen zwei Stunden lang prächtig unterhalten, da spielte meine Neigung keine Sekunde eine Rolle. Ich war auch vor Ort in Riad. Da wurde kein Wort drüber verloren. Und wenn ich mit einem Saudi händchenhaltend über den Campus marschiert bin, hat das meine Delegation amüsiert, aber so ist der Brauch in vielen arabischen Ländern und daraus wird nichts abgeleitet. Aber natürlich waren die Gastgeber informiert.
Fiel es Ihnen nie schwer, gute Miene zum bösen Spiel zu machen?
Bei Treffen mit Staatsoberhäuptern, von denen man weiß, dass sie in ihrem Land Homosexuelle bestrafen, gar verfolgen lassen, musste ich mich schon zusammennehmen, das ist mir nicht leichtgefallen. Aber als Regierender Bürgermeister muss man das auch trennen können von seinem Amt.
Sie haben nie etwas gesagt?
Doch, es gab so Vierer-Treffen zwischen den Bürgermeistern von Berlin, London, Paris und Moskau. Als der Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow in Berlin zu Gast war, wurde er von der Presse gefragt, warum der CSD in Moskau verboten würde. Und dann zog der vom Leder, wie unnatürlich und abnormal das alles sei, das war ganz großes Theater für die russischen Staatsmedien. Der Pariser Bürgermeister und ich haben dann dagegengehalten. Anschließend hat sich Luschkow aber mit Küsschen von uns verabschiedet. Das sind schon skurrile, filmreife Situationen. Gleichzeitig ist es aber auch erschreckend, dass so mächtige Männer eine solche Auffassung haben können und wie schnell diese Auffassung sich auch ändern kann. Erdogan und Putin waren ja zu Beginn ihrer Amtszeit wesentlich liberaler, da keimte ja schon fast Hoffnung auf, dass sich auch für die Minderheiten, und ich meine damit nicht nur die queere Community, in diesen Ländern etwas zum Positiven wandeln könnte. Das Gegenteil ist nun der Fall. Da geht es um Machterhalt und die Angst vor jedweder Opposition, anders ist so ein Backlash nicht zu erklären.
Bereiten Ihnen solche Rückschritte Sorgen, oder sind Sie da ganz abgeklärter Politiker?
Nein, das bereitet mir Sorgen. Man arbeitet immer mit der Hoffnung, dass die Welt eine bessere wird und die Menschen etwas lernen aus der Geschichte. Und plötzlich ist alles wieder hinfällig, das hat man ja bei Corona gesehen, wie schnell da geleugnet wurde, was zuvor als Allgemeingut galt. Ich beobachte auch die Situation innerhalb der queeren Community und die Debatten, die geführt werden um sexuelle und geschlechtliche Identität. Und zum Teil wird da sehr hart argumentiert, auch nicht immer liberal. Man sollte nicht glauben, dass nur weil jemand schwul oder lesbisch ist, auch automatisch Toleranz mit einhergeht. Wenn man sich nur die Lage der Transgender vor Augen führt, die Demütigung, die diese Menschen mitunter erfahren müssen, auch aus Reihen der LGBT-Community, und die Schicksale, die damit verbunden sind. Da ist noch längst nicht alles erreicht, was es zu erreichen gilt in Bezug auf Antidiskriminierung und Gleichberechtigung.
Können Sie nachvollziehen, dass manche Menschen den Überblick verlieren, wenn es beispielsweise um das Gendern oder die geschlechtliche Identität geht? Wenn man sich plötzlich mit Begrifflichkeiten wie „non-binär“, „Cis“ oder „she/her“, „he/him“ und „they“ auseinandersetzen muss?
Ein Stück weit sicherlich, da gibt es eben viele Unsicherheiten und es ist teilweise schwierig zu folgen. Aber man darf dieses Thema eben nicht aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft betrachten, sondern muss das aus Sicht der Betroffenen tun. Denn selbst wenn es verhältnismäßig wenig Schicksale sind, so sind es trotzdem Schicksale. Dahinter stehen immer Menschen, die Diskriminierung, Abwertung und fehlende Zuwendung erfahren haben. Im Jahr 2022 muss es doch selbstverständlich sein, dass jede und jeder sein eigenes Geschlecht bestimmen kann, ohne die demütigenden Prozeduren einer vermeintlichen Anerkennung durchlaufen zu müssen. Und das geht weiter bei der Sprache. Wenn jemand auf bestimmte Weise angesprochen werden will, halte ich das für legitim. Ob sich das dann in der Schriftsprache durchsetzt, ist etwas anderes.
Sind Sie eher Beobachter von außen, oder nehmen Sie am schwul-lesbischen Stadtleben und den Debatten dort noch aktiv teil?
Klar, ich sitze ja auch noch in Kuratorien und bin immer noch der Schirmherr des schwul-lesbischen Stadtfestes gemeinsam mit Elisabeth Ziemer von den Grünen. Aber ich würde jetzt beispielsweise nicht auf den CSD e.V. zugehen, um da irgendwas nach vorne zu bringen oder Kritik zu üben. Zum CSD gehe ich natürlich, ich weiß nur noch nicht, auf welchem Wagen ich mitfahren werde.
Man hat Ihnen lange das Etikett des „Feier-Bürgermeisters“ angehängt, viel mehr als das des harten Sparers. Fühlen Sie sich heute, fast ein Jahrzehnt nach Ihrem Amtsende, richtig betrachtet in der öffentlichen Wahrnehmung?
Nein, aber das ändert nichts daran. Es interessiert eben auch niemanden, schon gar nicht einen Fotografen, wenn man acht Stunden am Schreibtisch sitzt. Es bleiben eben nur die Fotos wie das mit dem roten Schuh, aus dem ich angeblich Champagner geschlürft habe, was natürlich absoluter Unsinn ist. So ein Etikett wird man nicht mehr los. Das bringt mich aber nicht um den Schlaf, denn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich geackert habe wie ein Pferd. Und zwar nicht nur beim Feiern. (lacht)
Ihrem Nachfolger Michael Müller wären solche Bilder nicht „passiert“.
Meinem Vorgänger auch nicht. Eberhard Diepgen war ja bei den meisten Partys auch dabei, man sah ihm nur eben immer an, dass es ihm keine Freude bereitet hat. Das war bei mir nicht so, also wurde die Kamera auf mich gehalten. Aber damit kann ich wirklich gut leben.