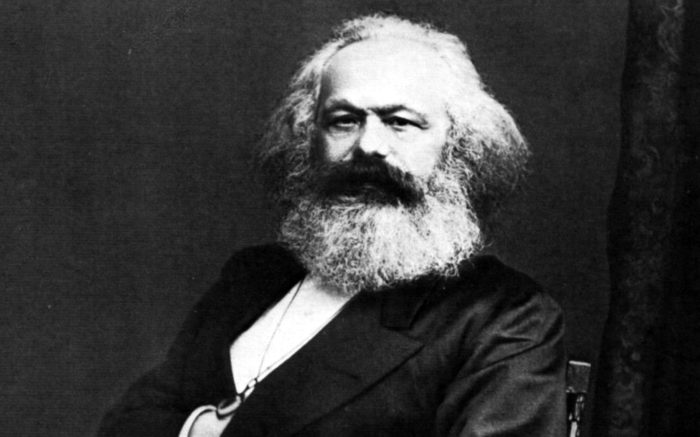Mit Keynes und Marx und darüber hinaus: Joan Robinson und eine ausstehende Revolution
Joan Robinson war eine der Großen der Ökonomie. Sie entwickelte Keynes weiter und musste Debatten mit Marx-Anhängern nicht aus dem Weg gehen. Ihre Fragen, welche Rolle Planung spielen kann oder ob Kapitalismus und Demokratie vereinbar sind, blieben bis heute aktuell. Ein Text aus der OXI-Nummer 11/2017.
Als eine der wenigen Frauen gelang es Joan Robinson, sich in der Welt der Ökonomen des 20. Jahrhunderts einen Namen zu machen. Für viele ihrer Zeitgenossen war sie zwar ein Enfant terrible, wurde für ihre Beiträge trotzdem hoch geschätzt. Exemplarisch gestand Paul A. Samuelson, Verfasser des US-amerikanischen Lehrbuchklassikers »Economics« ein, dass er den wenigsten Beiträgen Robinsons zustimme, ihr aber dennoch den Nobelpreis dafür gegönnt hätte.
Sie hat diesen Preis nie bekommen, bisher hat ihn überhaupt erst eine Frau (Elinor Ostrom 2009) erhalten. Auch Ökonomen jenseits des Mainstream kann man mit der Lupe suchen. Der Preis für Wirtschaftswissenschaften ist kein Nobelpreis im eigentlichen Sinn, sondern wird erst seit 1969 aufgrund einer Stiftung der schwedischen Reichsbank vergeben.
Anerkennung in ihrer Zunft erlangte Robinson als 29-Jährige mit ihrer ersten großen Veröffentlichung »The Economics of Imperfect Competition« im Frühjahr 1933. Dieses Buch wurde nie ins Deutsche übersetzt, taucht aber noch heute in jeder Vorlesung zur Wettbewerbstheorie zumindest in Fußnoten auf.
Noch während der Arbeit daran geriet sie in den Dunstkreis der sich abzeichnenden Keynesschen Revolution. Seit 1931 war sie Teil einer Diskussionsgruppe von Ökonomen, die maßgeblich am Entstehungsprozess von Keynes’ »Allgemeiner Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes« mitwirkte. Nach Veröffentlichung von »Imperfect Competition« hat sie sich nicht mehr weiter da- mit beschäftigt, ihren Ansatz vielmehr kritisiert: Er stehe in der Tradition der statischen Gleichgewichtsanalyse und führe deshalb in eine Sackgasse, wohingegen Keynes die Tür zur dynamischen Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung aufgestoßen habe.
Zumindest teilweise Planung von Investition und Einkommen
Nach Erscheinen von Keynes’ Hauptwerk veröffentlichte Robinson einerseits Aufsätze, in denen die Grenzen der Keynesschen Theorie benannt wurden. Dazu gehört die nicht beachtete Inflationsgefahr, die von einer erfolgreichen Vollbeschäftigungspolitik hervorgerufen wird, gehören aber auch offene Fragen der außenwirtschaftlichen Beziehungen, die eine binnenorientierte expansive Wirtschaftspolitik konterkarieren können.
Andererseits bemühte sie sich um die Popularisierung der neuen Gedanken und unterbreitete Vorschläge, wie eine konjunkturstabilisierende Politik dauerhaft umgesetzt werden könnte. Konkret plädierte sie für eine Einschränkung der Verfügungsgewalt über Privatvermögen und hielt eine zumindest teilweise Planung von Investition und Einkommen für unabdingbar. Als wichtigste Anforderung an die Nachkriegspolitik sah sie das »notwendige Maß an Planung mit den traditionellen Methoden der Demokratie zu vereinbaren«.
Robinson prägte den Begriff »Bastard-Keynesianismus«
Ein theoretischer Neuanfang und Lehren für die wirtschaftspolitische Praxis standen nach den Erfahrungen von Weltwirtschaftskrise und Krieg damals durchaus auf der Tagesordnung – wie es viele auch für die Zeit nach 2007 erwartet hatten. Doch auch damals wendete sich das Blatt schnell wieder. Die einsetzende und länger anhaltende Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wieder einmal als Normalität des Kapitalismus aufgefasst. Mehrere kleinere Rezessionen konnten mit sogenannter keynesianischer Politik überwunden werden. Robinson prägte dafür allerdings frühzeitig den Begriff »Bastard-Keynesianismus«.
Keynesianismus, als antizyklische Wirtschaftspolitik verstanden, hatte sie schon in den 1940er Jahren kritisiert. Privater Investition auf diese Weise den Vorzug zu lassen und dem Staat lediglich Lückenbüßerfunktion zuzuweisen, hielt sie für kurzsichtig. Außerdem zeichnete sich bald ab, dass viele Staaten diese Funktion vor allem über den Rüstungshaushalt ausfüllten und die so entstehenden Budgetdefizite mit Hinweis auf Keynes rechtfertigten. »Keynes’ angenehmer Tagtraum wurde so zu einem Alptraum des Terrors« – so Robinson.
»… die zum zweiten Mal nichts zu den Fragen zu sagen weiß«
Für sie kam daher die Wirtschaftskrise seit Beginn der 1970er Jahre nicht überraschend. Staatsverschuldung, Inflation, Weltwirtschaftskrise und die langsam ins öffentliche Bewusstsein dringenden ökologischen Grenzen des Wachstums förderten »den offensichtlichen Bankrott der ökonomischen Theorie« zutage, »die zum zweiten Mal nichts zu den Fragen zu sagen weiß, die für alle außer für Ökonomen dringlich einer Antwort bedürfen«.
So hart urteilte Robinson über ihre Zunft Ende 1971 in ihrem berühmt gewordenen Aufsatz »Die zweite Krise der ökonomischen Theorie«. Nach der ersten Krise zu Beginn der 1930er Jahre hat in ihren Augen der Keynessche Ansatz einen Ausweg gewiesen. Die Mehrheit der Ökonomen habe aber Keynes umgedeutet und seine Vorschläge in die Gleichgewichtstheorie integriert. Die Revolution stehe noch aus: »The Keynesian revolution still remains to be made both in teaching economic theory and in forming economic policy.«
Als mit Einsetzen des Kalten Krieges jedes auch noch so zurückhaltend formulierte Plädoyer für Planung sofort mit Zwang und Unfreiheit assoziiert wurde, zog sich Robinson in den wissenschaftlichen Elfenbeinturm zurück. Ihr Ziel war recht unbescheiden die Verallgemeinerung der »Allgemeinen Theorie« von Keynes, dessen Analyse sie auf kurzfristige Zusammenhänge beschränkt sah. Für den aktuellen Anlass, nämlich eine ökonomietheoretische Begründung der öffentlichen Beschäftigungsprogramme, die zwar aus politischer Notwendigkeit heraus durchgeführt wurden, nach der damals vorherrschenden Lehre aber jeglicher Grundlage entbehrten, war diese Beschränkung zunächst gerechtfertigt.
Rückkehr zu den Fragestellungen der Klassiker
Zukünftige theoretische Aufgaben sah Robinson aber in einer dynamischen Analyse, also einer Ausdehnung des Keynesschen Ansatzes auf die langfristige wirtschaftliche Entwicklung. Dies war für sie gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu den Fragestellungen der Klassiker und eine Abkehr von der Gleichgewichtstheorie der Neoklassik. Anhaltspunkte fand sie unter anderem bei einer neugierigen Lektüre des Marxschen »Kapital«, bei der Ricardo-Interpretation ihres Cambridger Kollegen Piero Sraffa und bei dem marxistischen Theoretiker Michal Kalecki, der schon in den 1930er Jahren zum Diskussionskreis um Keynes gehört hatte.
Robinsons 1956 erschienenes dynamisches Hauptwerk trug nicht zufällig den Titel »Die Akkumulation des Kapitals«. Sie nimmt zwar keine ausdrücklichen Anleihen bei Rosa Luxemburgs gleichnamigem Werk, hebt aber positiv hervor, dass Luxemburg das von Marx vernachlässigte Problem der Nachfrage vor allem nach Investitionsgütern thematisiert habe. Außerdem bescheinigt sie ihr mehr Voraussicht als jeder der orthodoxen neoklassischen Zeitgenossen beanspruchen könne.
Robinson legt in ihrer »Akkumulation des Kapitals« die notwendigen Voraussetzungen für ein gleichgewichtiges wirtschaftliches Wachstum dar. In den Blick geraten dabei vor allem der technische Fortschritt, das Arbeitskräftepotenzial und dessen Verhandlungsstärke, das wiederum von der Bevölkerungsentwicklung beeinflusst werden kann, Sparwille und Investitionsbereitschaft, aber auch institutionelle Bedingungen wie Wettbewerbsordnung oder Einkommensverteilung.
Das in der theoretischen Konstruktion mögliche gleichmäßige Wachstum bezeichnete sie als »Goldenes Zeitalter«, um damit anzudeuten, dass es in der ökonomischen Realität äußerst unwahrscheinlich ist. Die Fülle der logischen Voraussetzungen machen das Buch schwer lesbar. Sie sollen aber auch zeigen, dass sowohl außerökonomische als auch ökonomieimmanente Faktoren die Entwicklung immer wieder vom Gleichgewichtspfad abbringen und mehr oder weniger schmerzhafte Verwerfungen hervorrufen werden.
»I have Marx in my bones and you have him in your mouth.«
Durch die theoretische Möglichkeit eines gleichgewichtigen Wachstums unterscheidet sich die »Akkumulation des Kapitals« in Robinsons Version von der marxistischen Interpretation der Akkumulation. Mit dem tendenziellen Fall der Profitrate bei Marx oder der langfristig mangelnden Konsumnachfrage in Luxemburgs gleichnamigem Werk scheint dem Zusammenbruch des Kapitalismus eine theoretische Notwendigkeit einprogrammiert. Sie scheint einprogrammiert, weil es um die Frage des notwendigen Zusammenbruchs auch innerhalb des Marxismus endlose Debatten gibt.
Robinson als »externe« Sympathisantin hat zu den theoretischen Auseinandersetzungen in und mit dem Marxismus allerdings eher weniger beigetragen. Zwar bereiste sie mit großem Interesse die Sowjetunion und später vor allem China, um von planwirtschaftlichen Versuchen zu lernen. Anhängern des Marxismus wirft sie jedoch vor, Marx weniger als Analytiker zu schätzen, sondern als unfehlbaren Propheten.
Schon 1942 veröffentlichte sie »An Essay on Marxian Economics«, mit dem sie Marx‘ Forschungsprogramm skizzieren und in eine »für akademische Ökonomen« verständliche Sprache übersetzen wollte. Sicherlich hat sie daraus methodische Anregungen für ihr eigenes Forschungsprogramm gezogen, aber – zum Ärger von zeitgenössischen Marxisten – auch aus ihrer Sicht Grenzen bzw. Fehler der Marxschen Theorie benannt. Mit der Werttheorie konnte sie nichts anfangen und den tendenziellen Fall der Profitrate hielt sie für eine komplett zirkuläre Argumentation. Ganz sicher nicht beliebt gemacht hat sie sich mit Aussagen wie »Marxism is the opium oft he Marxists« oder sie verstehe Marx besser als Marxisten: »I have Marx in my bones and you have him in your mouth.«
Die Endlichkeit des Kapitalismus ist allerdings auch in der Keynesschen Theorie angelegt. Der »tendenzielle Fall der Profitrate« heißt dort »abnehmende Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals« oder weniger technisch »sanfter Tod des Rentiers«. Wie in den 1930er und den 1970er Jahren ist nach wie vor die Frage nach der Planung bzw. der Vereinbarkeit von Kapitalismus und Demokratie offen. Ein Fortschritt wäre immerhin, wenn Interessierte die Frage gemeinsam angehen und über ihre theoretischen Grundansichten auch mal hinwegsehen könnten.
Kurzbiografie
Joan Violet Robinson – ihr vorehelicher Name war Maurice – wurde am 31.Oktober 1903 als Tochter einer Familie der oberen englischen Mittelklasse geboren. Sie besuchte die St. Paul’s Girls‘ School und ab 1922 das Girton College in Cambridge, wo sie 1925 als Ökonomin graduierte. Nach ihrer Heirat mit Austin Robinson, ebenfalls Ökonom, folgte sie ihrem Ehemann nach Indien, der dort bis 1929 als Tutor des Maharadschas von Gwalior arbeitete.
Zurück in Cambridge wurde Joan Robinson 1931 zunächst als Assistentin an der ökonomischen Fakultät in Cambridge aufgenommen, 1937 wurde sie Dozentin, 1949 außerordentliche Professorin und erhielt schließlich einen Lehrstuhl von 1965 bis zu ihrer Emeritierung 1971. Bis kurz vor ihrem Tod am 5. August 1983 hielt sie jedoch Vorträge und Gastvorlesungen in mehreren Ländern und publizierte weiterhin zu Ökonomischen Fragen. Dank ihrer sozialen Stellung schaffte es Robinson, neben ihrer beruflichen Karriere auch noch zweifache Mutter zu werden. Im Mai 1935 wurde ihre Tochter Ann, im Oktober 1937 ihre Tochter Barbara geboren.
Ihre Sonderstellung als Frau in der auch heute noch fast ausschließlich von Männern besetzten Domäne der Wirtschaftswissenschaften problematisierte Robinson nie. Sie hielt in ihren ökonomischen Schriften selbst an der traditionellen geschlechtsspezifischen Rollenzuweisung fest, indem sie z.B. Frauen als die für den Familienunterhalt einkaufenden »Konsumenten« bezeichnete. Sich selbst verstand sie in dieser Beziehung offensichtlich als geschlechtsloses Wesen und hasste nichts mehr, als als Größte unter den weiblichen Ökonomen bezeichnet zu werden. Ihr Maßstab waren ihre männlichen Kollegen.
Sabine Reiner ist Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Gewerkschaftssekretärin bei ver.di.
Guter Journalismus ist nicht umsonst…
Die Inhalte auf oxiblog.de sind grundsätzlich kostenlos. Aber auch wir brauchen finanzielle Ressourcen, um oxiblog.de mit journalistischen Inhalten zu füllen. Unterstützen Sie OXI und machen Sie unabhängigen, linken Wirtschaftsjournalismus möglich.
Zahlungsmethode