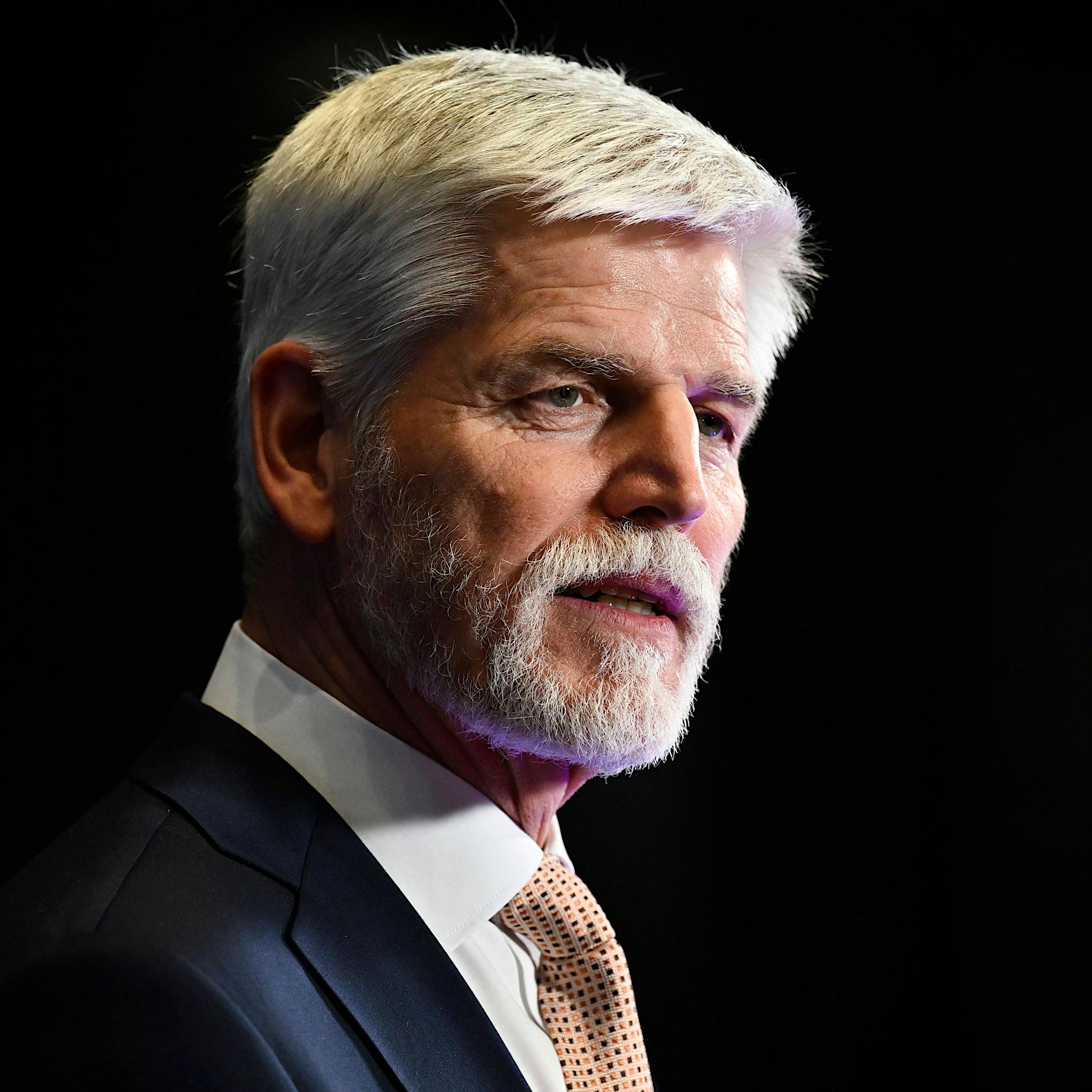Berliner Zeitung: Herr Verheugen, Sie haben Ihre Karriere als FDP-Außenpolitiker begonnen. Der legendäre Hans-Dietrich Genscher war ein Mann des Dialogs und der Aussöhnung. Wie haben Sie ihn erlebt?
Günter Verheugen: Ich folgte Genscher 1974 in das Auswärtige Amt. Später saßen wir uns zehn Jahre lang im Auswärtigen Ausschuss gegenüber. Ich habe von ihm gelernt, dass man, egal was auch geschieht, immer miteinander reden muss. Man darf niemals die Gesprächskanäle abreißen lassen. Man muss bei allen Gegensätzen und bei allen Konflikten immer versuchen, das Gemeinsame zu suchen. Genschers Prinzip, das ich teile, war Kooperation, nicht Konfrontation.
Nach dem Fall der Mauer und dem Untergang der Sowjetunion waren Sie einer der Vordenker der Europäischen Union. Welche EU stand den Politikern damals vor Augen?
Es war für uns alle völlig klar, das ein vereintes Deutschland nur im Rahmen eines vereinten Europas für die übrigen Europäer dauerhaft erträglich sein würde. Ein völlig ungebundenes Deutschland kam nicht in Frage. Uns war zugleich völlig klar, dass ein integriertes Europa nur funktionieren würde, wenn es einen engen Schulterschluss zwischen Deutschland und Frankreich gibt. Der traurige Zustand der EU auf der internationalen Bühne rührt daher, dass es den Gleichklang zwischen Deutschland und Frankreich nicht mehr gibt.
Kam der Bruch nur von der deutschen Seite?
Die Franzosen haben immer versucht, den Deutschen klarzumachen, dass es ein autonomes, in eigener Verantwortung handelndes Europa braucht. Unmittelbar nach der Wende, nach dem Zerfall der Sowjetunion, gab es eine kurze Phase, in der ein eigenständiges Europa möglich gewesen wäre. Das drückte sich in der Charta von Paris aus, Gorbatschow sprach vom gemeinsamen europäischen Haus. Da hat man den Schritt nicht getan, sich von den USA zu emanzipieren, weil das die Nato in ihren Grundlagen verändert hätte. Ich war nie der Meinung, dass man die Nato aufgeben müsse. Aber ich habe mir damals vorgestellt, die Nato könnte ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem in einem politischen Bündnis mit den USA und Kanada werden, eine Art OSZE plus. Damals wurde auch ernsthaft erwogen, auch in den USA, Russland die Mitgliedschaft in der Nato anzubieten.
Meistgelesene Artikel
Wer wollte das in den USA?
Die Clinton-Administration hat ernsthaft darüber nachgedacht. Sie hat das fallengelassen, weil die USA ihre dominante Rolle in Europa nicht aufgeben wollten. Heute sind all die schönen Reden über die Autonomie Europas das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt werden. Für einen großen Teil der neuen EU-Mitglieder ist die von den USA garantierte Sicherheit wichtiger als ein eigenständiges europäisches Handeln. Der nukleare Schirm ist der springende Punkt. Wir haben uns in der EU bequem eingerichtet, weil wir die eigene territoriale Verteidigung nicht mehr für nötig hielten. Heute stehen wir vor dem Scherbenhaufen – nicht nur in Deutschland.
Wurde die Idee eines eigenständigen Europas jemals ernsthaft diskutiert?
Selbstverständlich. Vaclav Havel war ursprünglich ganz entschieden dafür. Er sagte: Wir brauchen dieses gemeinsame Haus Europa, also eine umfassende Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Aber die Amerikaner haben ihm gesagt: Junge, das meinst du doch nicht ernst? Willst du die Deutschen in einer Lage haben, wo sie machen können, was sie wollen? In der Nato haben wir sie unter Kontrolle.
Welche Befürchtungen hatten die Amerikaner? Deutschland war nach 1945 in der Westbindung, welche Gefahr hätte von den Deutschen ausgehen sollen?
Täuschen Sie sich nicht! Wir Deutschen neigen dazu, das zu glauben. Aber wenn Sie die Amerikaner und unsere Nachbarn gut kennen, dann wissen Sie, dass das nur der Firnis ist. Darunter steckt ein tiefes Misstrauen, dass von den Deutschen wieder ein Krieg ausgehen könnte. Ich glaube, unser Land zu kennen und bin überzeugt, dass kaum ein Land so weit davon entfernt ist, einen Krieg anfangen zu wollen. Aber ich weiß, dass diese Angst in vielen anderen Ländern real existiert.
Haben die deutschen Politiker die deutsche Friedfertigkeit so schlecht kommuniziert?
Das ist keine Frage unserer Kommunikation, sondern eine Frage der historischen Erfahrung unserer Opfer. Wir sind jetzt fast 80 Jahre nach Kriegsende und Polen beginnt eine Debatte über Reparationszahlungen.
Woran liegt das – am Populismus oder sind die Wunden so tief?
Ich glaube, die Wunden sind so tief. Das gilt für Polen, die Ukraine, Belarus, Russland und die anderen Länder der früheren Sowjetunion – es gibt keine Familie, die nicht Menschen verloren hat. Das sind die Länder, die die größten Opfer bringen mussten, das verschwindet nicht innerhalb weniger Generationen.

Aber dann stünde Deutschland doch vor dem Problem, dass man eigentlich nicht Panzer schicken dürfte, die auf Russen schießen.
Ich glaube, die Regierung sieht hier ein moralisches Dilemma. Es hat den Charakter einer griechischen Tragödie. Was man macht, ist falsch: Liefert sie Waffen, treibt sie die Eskalationsspirale an und verlängert Leiden und Sterben. Tut sie es nicht, wird ihr vorgeworfen, sie beuge sich der Gewalt.
Aber es ist keine Tragödie auf einer Bühne, sondern die Erde dreht sich weiter. Irgendeine Lösung wird es geben.
Ich vermisse die schonungslose Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte. Ich bin überzeugt, dass im Jahr 2008 mit dem Angebot an die Ukraine, Nato-Mitglied zu werden, willentlich und wissentlich eine Linie überschritten wurde, und dass dies für Russland wegen seiner Sicherheitsinteressen nicht hinnehmbar war. Obama hat Russland als eine Regionalmacht verspottet. Die EU hat den Beitritt der Ukraine vorangetrieben, ohne mit dem Nachbarn Russland zu reden. Russen und Ukrainer haben aber vielfache kulturelle, wirtschaftliche und soziale Bindungen. Bei der Ost-Erweiterung der EU haben wir Russland kein Mitspracherecht eingeräumt, aber es gab Themen, die wir mit den Russen besprechen mussten – die Frage der russischen Minderheiten in den baltischen Staaten, Kaliningrad – natürlich haben wir mit den Russen darüber geredet, und zwar mit Erfolg. Die Vereinbarungen mit Russland, die wir geschlossen haben, haben alle gehalten.
Was ist denn von der Bereitschaft der Amerikaner, die Russen in die Nato zu holen, bis zum Fiasko mit dem EU-Beitritt der Ukraine passiert, dass sich alles so gedreht hat?
Es gab kein einzelnes Ereignis. Aber die Amerikaner haben in den 1990er-Jahren eine Sicherheitsdoktrin entwickelt, die gesagt hat: Nirgendwo auf der Welt darf es eine Macht geben, die stärker ist als wir; wir wollen überall die Nummer eins sein. Der Wiederaufstieg Russlands zu einem globalen Rivalen musste verhindert werden. Hinzu kommt, dass man in Washington sehr misstrauisch ist, wenn Deutsche und Russen sich verständigen.
Während der Zeit von Jelzin waren die Amerikaner näher an den Russen als die Deutschen. Da gab es eine Zeit, wo die Amerikaner Russland sehr unterstützt haben …
… und ausgebeutet! In den wilden 90er-Jahren waren die Russen schwach. Ihre Wirtschaft war völlig ungeregelt. Es herrschte Raubtierkapitalismus. In dieser Zeit wurde das russische Volk beraubt, von westlichen Glücksrittern, Kriminellen und von den aufstrebenden Oligarchen.
Sie waren zu dieser Zeit bereits Außenpolitiker der Sozialdemokraten in der Opposition. Hat in der Zeit der Raubritter in Russland eine SPD gefehlt, die gesagt hat, das muss man anders machen?
Das hat die SPD ja gesagt. Egon Bahr musste sich mit dem Vorwurf der „Sonderaußenpolitik“ herumschlagen. Er ist bei der Linie geblieben, dass man mit Russland im Gespräch bleiben muss, in erster Linie bei den Fragen Abrüstung und Rüstungskontrolle. Im übrigen findet sich der Ansatz der SPD – Kooperation statt Konfrontation – auch in der strategischen Partnerschaft der EU mit Russland wieder, die einige Jahre sehr gut funktionierte. Bezüglich der Ukraine wurde leider der Fehler gemacht, dass die EU gesagt hat, das Land müsse sich entscheiden zwischen EU und Eurasischer Union. Das war falsch, denn mit der Ukraine als Scharnier hätte die Idee eines Wirtschaftsraums von Lissabon bis Wladiwostok verwirklicht werden können.
Heute wird der SPD der Vorwurf gemacht, dass „Wandel durch Handel“ ein falscher Ansatz gewesen ist.
Das ist nie eine politische Leitlinie gewesen. Es hieß nie „Wandel durch Handel“, sondern „Wandel durch Annäherung“. Das ist wörtlich zu verstehen. Man nähert sich jemandem, um mit ihm über Konflikte und Probleme sprechen zu können.
Sie waren EU-Kommissar zur Zeit der EU-Osterweiterung. In welchem Geist wurde da verhandelt?
Das Wichtigste war, dass die künftigen neuen Mitgliedstaaten sich auf gemachte Zusagen verlassen konnten. Es ging um Vertrauen. Der Leitgedanke war, den Bewerbern die Sicherheit zu geben, dass sie wirklich gewollt waren und dass die EU sie braucht. Wir sind heute in der Misere, in der wir sind, weil das gegenseitige Vertrauen völlig verloren gegangen ist.
Ein Bespiel dafür ist die Aussage Angela Merkels, man habe die Minsker Vereinbarungen nur geschlossen, um Zeit zu gewinnen. Was hat das bewirkt?
Ich weiß nicht, warum Merkel das gesagt hat und ob es überhaupt stimmt. Das Ergebnis ihrer Aussage ist jedoch, dass die EU, Frankreich und Deutschland, als mögliche Vermittler völlig aus dem Spiel genommen wurden. Das wird uns auch weltweit, etwa bei Verhandlungen mit dem globalen Süden, noch lange schaden.
Gab es bei der Ost-Erweiterung der EU schon die Überlegung, man müsse Russland eindämmen?
Nein. Es gab die europäische Nachbarschaftspolitik, die ursprünglich so konzipiert war, dass um die EU herum ein „Ring von Freunden“ entstehen sollte. Mit jedem einzelnen Land sollte das individuell umgesetzt werden, je nach Zielen, Bedürfnissen und Möglichkeiten, und so entstand auch die strategische Partnerschaft mit Russland. Wir waren dabei, auf wichtigen Feldern eine gesamteuropäische Kooperation zu erreichen.
Hatten Sie den Eindruck, dass es in Russland eine Entwicklung in Richtung Demokratie gab?
Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Man kann ja eine Demokratie nicht einfach von außen verordnen. Ich bin von der Demokratieentwicklung in Russland enttäuscht. Es ist ganz eindeutig, dass die Haltung der russischen Eliten und der Führung repressiv geworden ist. Regime-Change-Fantasien des Westens waren der Entwicklung der Demokratie in Russland auch bestimmt nicht förderlich. Die Idee eines von außen herbeigeführten „Regime Change“ in Russland ist völlig unrealistisch. Und auch noch brandgefährlich.
Warum haben die EU-Verhandlungen mit der Türkei zu keinem Ergebnis geführt – und was ist die Folge?
Das ist eine der ganz großen ungelösten Aufgaben der EU. Vor 20 Jahren war die Türkei ganz klar auf dem Weg, alle Beitrittsbedingungen zu erfüllen. Dieser Reformprozess brach ab, weil Angela Merkel und Jacques Chirac die Türkei nicht in der EU wollten. Sie haben gesagt, die Türkei gehöre nicht zu Europa, aus kulturellen Gründen. Ich halte das für fundamental falsch. Und den Verfechtern eines christlichen Abendlandes sei gesagt, dass sich die ältesten Stätten der Christenheit in der Türkei befinden. Viele Entwicklungen in der Türkei wären anders verlaufen, wenn die Türkei in die EU gekommen wäre. Ich will nicht sagen, dass die EU heute dafür verantwortlich ist, was Erdogan macht. Aber die EU ist dafür verantwortlich, dass sie keinen Einfluss mehr hat auf das, was in der Türkei heute geschieht. Sie hat sich mutwillig des wichtigsten Instruments der Einflussnahme begeben. Unabhängig von Erdogan sollte die EU umgehend ihre Richtung ändern und der Türkei wieder eine verlässliche Perspektive anbieten. Sonst ist die Türkei für die EU endgültig verloren.
Wir sehen heute in Europa eine Entwicklung, in der wir statt Kooperation Konfrontation haben, das Recht des Stärkeren, Krieg ist wieder im ein alltägliches Instrumentarium der Politik. Wie bewerten Sie das?
Wir müssen jeden einzelnen Verstoß gegen die UN-Charta mit dem Gewaltverbot und dem Nichteinmischungsprinzip und gegen die KSZE-Akte von Helsinki ächten und uns wieder auf die Charta von Paris besinnen. Denn es geht um eine Menschheitsaufgabe. Wir müssen endlich lernen, wie wir friedlich auf diesem Planeten zusammenleben können.
Was müsste Deutschland tun, um aus der Sackgasse zu kommen?
Deutschland muss gemeinsam mit Frankreich eine EU schaffen, die bereit und in der Lage ist, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist kein Selbstzweck, sondern eine Bedingung dafür, dass wir in der Welt überhaupt noch eine Rolle spielen. Dazu müssen wir auch unsere Einstellung zu den Ländern des globalen Südens grundlegend ändern. Diese Länder sind es leid, von uns ständig belehrt zu werden. Als gleichberechtigter Akteur auf der internationalen Bühne, ohne jede Supermachtambition, könnte die EU auf Augenhöhe bei der Lösung der globalen Probleme mitwirken, statt nachvollziehen zu müssen, was andere beschließen. Wir haben das Potenzial, eine unabhängige Stimme in der Völkergemeinschaft zu sein. Wir können sehr viel mehr, als wir zur Zeit leisten. Das ist „nur“ eine Frage des politischen Willens.
Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de