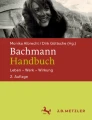Zusammenfassung
Sigmund Freud (1856–1939) ist als Begründer der Psychoanalyse einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er entstammte einer assimilierten, säkularen jüdischen Kaufmannsfamilie und erfuhr keinerlei religiöse Erziehung. Zeit seines Lebens stand er der Religion kritisch bis ablehnend gegenüber, hat aber doch auch dazu beigetragen, Religion zum wissenschaftlichen Gegenstand zu machen. Einerseits steht Freuds Mose-Buch zwischen verschiedenen Disziplinen und gilt vor allem den historischen Wissenschaften als hoch spekulativ. Andererseits werden vor allem in der Soziologie die Implikationen für die religionssoziologische Theoriebildung geschätzt. Darüber hinaus gilt er in den Kulturwissenschaften als Pionier der Frage nach dem kulturellen Gedächtnis.
Similar content being viewed by others
1 Autor und Genese des Werkes
Sigmund Freud wurde am 06.05.1856 in Freiberg (Mähren) geboren. Nach dem Schulbesuch in Wien studierte er ab 1873 Medizin ebenda und schloss das Studium 1881 ab. Die Habilitation erfolgte 1885. Danach hatte er eine Privatdozentur für Neuropathologie an der Universität Wien inne und praktizierte fortan als Nervenarzt in Wien. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 zwang ihn ins Exil nach Großbritannien, wo er bis zu seinem Tod am 23.09.1939 im Londoner Stadtteil Hampstead weiterhin forschte und praktizierte. Als Begründer der Psychoanalyse ist er einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Freud entstammte einer assimilierten, säkularen jüdischen Kaufmannsfamilie und erfuhr keinerlei religiöse Erziehung. Zeit seines Lebens stand er der Religion im Allgemeinen kritisch bis ablehnend gegenüber, hat aber doch auch dazu beigetragen, Religion zum wissenschaftlichen Gegenstand zu machen (vgl. Riesman 1972, S. 145). Wesentliche frühe Einflüsse auf diese Haltung stammen von Schopenhauer, Feuerbach und Nietzsche. Freud hat sich in seinen Forschungen, vor allem im Kontext der Frage nach dem Ursprung der Neurose, immer wieder mit dem Thema der Religion befasst, so in seinem weit rezipierten Werk Totem und Tabu von (1989a). Freuds Anschauungen über Religion sind stark dem Werk James George Frazers verpflichtet, insbesondere was die Adaption des Modells der religiösen Evolution mit den Entwicklungsstadien des magischen Denkens, des Animismus, des Polytheismus, des Monotheismus und der schließlichen Überwindung der Religion durch die Wissenschaft betrifft. Weitere wesentliche Einflüsse auf Freuds Schriften zur Religion stammen von William Robertson Smith (insbesondere im Hinblick auf den Totemismus), Edward Burnett Tylor und Émile Durkheim, mit dem er den Optimismus der Überwindung religiösen Denkens teilte.
Der Mann Moses und die monotheistische Religion ist das letzte zu Lebzeiten publizierte Werk Freuds und setzt sich aus drei ursprünglich selbstständigen Abhandlungen zusammen, die – zunächst als Vorträge gehalten – 1937 bzw. 1938 in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Imago separat erschienen und mit der dritten Abhandlung 1939 kurz vor seinem Tod zusammen in einer Publikation zusammengefasst worden sind.Footnote 1 Die deutlichen Inkongruenzen und Redundanzen der Studie sind u. a. diesem Entstehungsprozess geschuldet. Ursprünglich hatte Freud 1934, inspiriert durch die ersten Bände von Thomas Manns Joseph-Trilogie, einen historischen Roman mit dem Titel Der Mann Moses geplant, diesen Plan jedoch dann verworfen. Die Beschäftigung mit dieser religionsgeschichtlichen Thematik wurde angeregt vor allem durch die archäologischen Entdeckungen aus Tell el-Amarna in Ägypten, dem alten Achetaton (britische Ausgrabungen durch Flinders Petrie seit 1891, deutsche durch Ludwig Borchardt von 1911–1914), des Regierungssitzes des sogenannten „Ketzerkönigs“ Amenophis IV./Echnaton (ca. 1353–1336 v. Chr.) sowie durch die sensationelle Entdeckung des Grabes seines zweiten Thronfolgers, Tutanchamun (ca. 1332–1323 v. Chr.), durch Howard Carter 1922. Freud nahm als begeisterter Sammler ägyptischer Altertümer regen Anteil an den Neuentdeckungen der Ägyptologie seiner Zeit.
2 Zentrale Inhalte und Aussagen des Werkes
Der mit Moses, ein Ägypter überschriebene erste und kürzeste Teil der Abhandlung widmet sich der Herkunft des Mose, wobei Freud zuerst die ägyptische Herkunft des Namens erläutert, der ‚Kind‘ bedeutet und Bestandteil vieler theophorer Namen war (ägyptisch mś wie in Thutmoses, Ramses etc., Anmerkung RS). Freud deutet die biblische Auffindungsgeschichte des Mose im Weidenkörbchen durch eine Tochter des Pharao auf dem Hintergrund des in der Antike weit verbreiteten Mythos-Typs der besonderen Geburt des Helden, hier in einer Variante, die die besondere Bewahrung des Kindes hervorhebt. Er geht hierbei von einer Struktur des Mythos aus, der zwischen der realen, niedrigen Herkunft des Helden und der fiktiven, vornehmen Familie unterscheide, kehrt aber diese Struktur um, indem er die königliche, ägyptische Herkunft des Mose als die reale postuliert, um damit ein Argument für seine ägyptische Herkunft zu gewinnen. Freilich, dies betont der Verfasser, genügen der ägyptische Name und der mit ihm verbundene Mythos noch nicht zwingend dazu anzunehmen, Mose sei ein Ägypter gewesen.
Im zweiten Teil, überschrieben mit Wenn Mose ein Ägypter war, spielt er ebendiese Möglichkeit durch und bringt das Paradox zur Sprache, dass Mose – trotz seiner vermuteten ägyptischen Herkunft – in der jüdischen Tradition als Religionsstifter und Gesetzgeber der Juden gelte. Wenn Mose aber ein Ägypter war, konnte er als neue Religion nur die ägyptische an die Juden vermittelt haben. Da nun der Unterschied zwischen dem ägyptischen Polytheismus und dem jüdischen Monotheismus deutlich sei, müsse es sich bei der Form der ägyptischen Religion, die er vermittelt habe, um den Aton-Monotheismus des EchnatonFootnote 2 gehandelt haben. Echnaton habe hierbei nicht nur auf den bereits bestehenden Kult des Sonnengottes aufgebaut, sondern eine neue Lehre von einem universellen Gott kreiert, dem vor allem das Moment der Ausschließlichkeit eigne (Freud 1989b, S. 473). Die hebräische Anrede Gottes als ‚Adonai‘ könne hierbei ein sprachlicher Nachklang von Aton sein. Freud gesteht sich hier seine philologische Inkompetenz ein (ebd., S. 476) und versucht den Nachweis über religiöse Praktiken zu führen: Mose habe die ägyptische Praxis der Beschneidung übernommen, damit die Juden nicht hinter den Ägyptern zurückstehen und so ein heiliges Volk werden konnten. Die Beschneidung wird im dritten Teil als symbolischer Ersatz der Kastration gedeutet, der Triebverzicht als Motor der Ethik und des Fortschritts der Geistigkeit. Freud spekuliert, Mose sei möglicherweise ein ägyptischer Provinzstatthalter in der Zeit Echnatons gewesen, der sich in Ägypten siedelnde Semiten untertan gemacht hätte und diese nach Palästina geführt habe. Gegen Einwände, die für ein späteres Datum des Exodus (wie damals zumeist angenommen im 13. Jh. v. Chr., der Ramessidenzeit) sprächen, führt Freud an, dass die religiöse Tradition in den ägyptischen Priesterschulen hätte weiter existieren können. Im Anschluss an eine These von Ernst Sellin (1922)Footnote 3 spekuliert Freud weiter, hätten die Israeliten ihren Religionsstifter ermordet und die von ihm gestiftete Religion aufgegeben. Durch die Vereinigung mit anderen semitischen Stämmen und unter midianitischem Einfluss hätten sie dann den auf dem Sinai beheimateten blutrünstigen Vulkangott Jahve (Freud 1989b, S. 484)Footnote 4 zum allen Stämmen gemeinsamen Gott gemacht und die Mose- und Auszugstradition auf diesen Gott übertragen, dessen Charakteristika sich mit denen des Aton amalgamiert haben. Im Zuge der Verschriftlichung und schließlich der Fixierung des Bibeltextes in der Zeit Esras und Nehemias um 400 v. Chr. habe sich die Jahvereligion dann aber wieder zum ursprünglichen reinen Monotheismus der Mose-Religion zurückgebildet und auch ihren ursprünglichen ethischen Gehalt und die der Aton-Religion eignende Forderung der Exklusivität der Verehrung eines einzigen Gottes zurückgewonnen und den Charakter der Exklusivität noch verstärkt (ebd., S. 496 ff.). Die Trägergruppe dieser Tradition sei die dem Mose ergebene (ursprünglich ägyptische) Schreiber- und Priesterelite der Leviten gewesen.
Der dritte und längste Teil (Moses, sein Volk und die monotheistische Religion) fasst noch einmal (mit einigen Relativierungen hinsichtlich des Datums des Auszugs) die bisherigen Aussagen zusammen und widmet sich im Wesentlichen der Frage nach dem Durchbruch der Mose-Tradition in der jüdischen Religion und den psychologischen Vorgängen dieser Transformation, die er als Phänomen der Massenpsychologie bestimmt (ebd., S. 516). Die Analogie für diesen Durchbruch der ursprünglichen Mose-Religion sei die Genese von Neurosen durch ein frühkindliches Trauma, wobei nach einer Latenzzeit das vergessene Erleben wieder erinnert werde und zu einer Fixierung auf das Trauma und zu einem Wiederholungszwang führe. Diese „archaische Erbschaft“ aber habe unbewusst weiter gewirkt und eine Dynamik zur Wiederholung erzeugt. Das Schema von Trauma – Abwehr – Latenz und Ausbruch wendet Freud im Anschluss an seine in Totem und Tabu (1989a) entwickelte Theorie des urzeitlichen Vatermordes und seine Bewältigung auf die Entwicklung der jüdischen Religion und die Genese des Christentums an, wobei er die Mechanismen der Individualpsychologie auf diejenigen der Massenpsychologie überträgt. Der Durchbruch der alten Mosetradition im Judentum wird als Wiederholung und Bewältigung dieses urzeitlichen Vatermordes gedeutet: Der Mord am Religionsstifter (Sellin 1922) habe hierbei im jüdischen Volk ein andauerndes Trauma der Schuld mit Zwangscharakter erzeugt, das zunächst in eine messianische Hoffnung mündete. Auch das Christentum sei von der Ambivalenz des Vaterverhältnisses bestimmt und entthrone als Sohnesreligion den alten jüdischen Vatergott. Das Christentum sei zwar einerseits eine kulturelle Regression, da es Elemente des Polytheismus wiederaufnehme, stelle aber anderseits religionsgeschichtlich insbesondere im Hinblick auf den Bezug auf die Wiederkehr des Verdrängten, einen Fortschritt dar. Durch die Wiedereinsetzung des Vatergottes in Gestalt von Jesus durch Paulus sei das Judentum letztlich zu einem „Fossil“ geworden (Freud 1989b, S. 536). Auch die Feindschaft gegenüber den Juden – in der Vergangenheit und in der Gegenwart – wird von Freud auf den ursprünglichen Vatermord zurückgeführt: Die Juden leugnen den Vatermord, während die Christen ihn bekennen und dadurch von ihrer Schuld gereinigt seien: „Sie haben damit gewissermaßen eine tragische Schuld auf sich geladen; man hat sie schwer dafür büßen lassen“ (ebd., S. 581).
3 Einordnung in das Fachgebiet, Rezeption und Würdigung
Freuds Mose-Buch ist schwer einem Fachgebiet zuzuordnen, es steht zwischen Psychologie, Religionswissenschaft, Ägyptologie und Alttestamentlicher Wissenschaft. In der Perspektive der Religionswissenschaft und der historischen Wissenschaften gilt das Buch als hoch spekulativ. Im Kontext von Freuds Werk ist es durchaus eine folgerichtige Anwendung der psychoanalytischen Methode auf religionsgeschichtliche Prozesse und ihrer Erprobung an kollektiven Phänomenen, insbesondere als Testfall für die Aufklärung des Problems des Antisemitismus (Mayer 2016, S. 182 f.). Methodisch ging er wie ein Archäologe vor, indem er sich dafür interessierte, welche Spuren die Religion über die Vergangenheit eines Volkes hinterlasse habe. Dabei interpretierte er Religion wie Mythen und Träume auf genetische und „ökonomische“ Weise (vgl. dazu Riesman 1972, S. 128; Mayer 2016, S. 183). Die Idee freilich, den Ursprung des biblischen Monotheismus im Aton-Monotheismus des Echnaton zu suchen, war nicht neu und Freud hat sie in dieser Form von seinem ägyptologischen Hauptgewährsmann, James Henry Breasted übernommen, vor allem seinem (1933) erschienenen Dawn of Conscience. Auch Thomas Mann hat seine Hauptfigur Joseph in Joseph und seine Brüder in den Regierungszeiten Amenophis III.-IV. angesiedelt. Die religionsgeschichtliche Hauptthese war damit eigentlich wenig originell, sondern greift eine bereits popularisierte These auf, die allerdings auch heftigen Widerspruch sowohl von alttestamentlicher wie ägyptologischer Seite hervorrief, die zu Recht die je kulturimmanenten Entwicklungen geltend gemacht haben. Aufgrund des zeitlichen Hiatus von mehr als 700 Jahren (die Herausbildung des alttestamentlichen „Monotheismus“ wird in der heutigen Forschung zumeist in die Spanne von der späten Königszeit, dem 7./6. Jh. v. Chr., bis in die exilisch-nachexilische Zeit, dem 6.–4. Jh. v. Chr. datiert) und der unterschiedlichen Phänomenologie der Götter (Aton ist ein Sonnengott und war in Ägypten ursprünglich primär Gegenstand gelehrter, theologischer Konstruktion und weniger eine Gottheit mit „Alltagsrelevanz“, Jahwe ein kriegerischer Wettergott des Baal-Typs) wird die These einer direkten Abhängigkeit heute nicht mehr ernsthaft diskutiert. Zudem gilt die Figur des Mose heute weithin als unhistorisch und die Fokussierung auf den Typus des Religionsstifters als religionswissenschaftlich problematisch. In der Religionssoziologie dagegen firmiert Freud einerseits als Vertreter der klassischen Religionskritik, vor allem steht er im Anschluss an Feuerbach für die Projektions- bzw. Kompensationsthese (vgl. dazu Matthes 1967, S. 70). Andererseits wird er aufgrund seiner Grundprämisse, dass Religion sich nicht aus sich heraus, sondern aus der menschlichen Situation heraus verstehen lasse (vgl. Riesman 1972, S. 132) auch als Funktionalist verstanden, der aufgrund seiner Beobachtungen an Kindern und Neurotikern sowie ethnologischen Berichten die Religion in die Nähe einer Neurose rückt bzw. Religion als kollektive Zwangsneurose auffasst (vgl. Knoblauch 1999, S. 30 f.), die wie jede andere Neurose ihren Ursprung im Ödipuskomplex habe (vgl. Riesman 1972, S. 132). Als „illusionäre Wunschvorstellung“ erfülle Religion drei Funktionen: Sie gebe den Menschen „Aufschluß über Herkunft und Entstehung der Welt, sie versichert ihnen Schutz […] in den Wechselfällen des Lebens, und sie lenkt ihre Gesinnungen und Handlungen durch Vorschriften, die sie mit ihrer ganzen Autorität vertritt“ (Freud, zitiert nach Knoblauch 1999, S. 31 f.).
Freuds kontroverse Thesen zu Moses sind hauptsächlich in einer eher auf eine breite Leserschaft zielenden kulturwissenschaftlichen Essayistik rezipiert worden. In den Fachwissenschaften stieß und stößt sie überwiegend auf Skepsis, auch wenn sie (freilich ohne den psychologischen Deutungsrahmen) von einigen wenigen Fachwissenschaftlern bis ins 20. Jahrhundert hinein immer mal wieder aufgegriffen worden ist. Auch innerhalb des Kreises der von Freud beeinflussten und angeregten psychoanalytischen Schule stieß das Buch auf wenig Zustimmung. Eine erneute intensive Auseinandersetzung mit Freuds Mose-Buch begann mit Jan Assmanns Moses the Egyptian (Original englisch 1997, deutsche Ausgabe 1998), der die Thematik in mehreren weiteren Artikeln und Monographien (Assmann 2003) ventiliert hat, zuletzt in Exodus: Die Revolution der Alten Welt (2015). Assmann erkennt in Freud, insbesondere in der Theorie der „Wiederkehr des Verdrängten“, einen Wegbereiter der Theorie des kulturellen Gedächtnisses. Die Revitalisierung der Freudschen Monotheismus-Thesen in Jan Assmanns Arbeiten zu Mose und dem Aton-Monotheismus als „Gedächtnisspur“ stießen aber ebenso in der Fachwissenschaft nicht ungeteilt auf positive Resonanz. Ähnlich wie Assmann sieht auch Derrida (1997) die Mose-Studie als Wegbereiter der Theorie des kulturellen Gedächtnisses.
Intensiv wurde der Mann Moses von dem Soziologen Ulrich Oevermann rezipiert, vor allem die Implikationen für die sozialisationstheoretischen wie die religionssoziologische Theoriebildung. Schon in Totem und Tabu habe Freud mit der These des Vatermordes der Urhorde ein systematisches theoriearchitektonisches Problem zu lösen versucht, nämlich „die Erklärung der Universalität des ontogenetischen Prozesses als eines kulturellen“ (Oevermann 1995, S. XIII). Dieser ursprüngliche Mord führe nach Freud „die Leistung der ontogenetischen Stufenbildung als Kulturleistung“ zwar grundsätzlich ein, wobei er diese Leistung jedoch nicht als eine erklären konnte, die in jeder Ontogenese von neuem aufgrund der sozialisatorischen Konstellation entstehe. Stattdessen habe er auf ein neo-lamarckistisches Erklärungselement zurückgegriffen und den mit Schuld verbundenen Vatermord in die „hereditäre Konstitution des Einzelexemplars absinken“ lassen (ebd.).Footnote 5 Das gleiche Problem wiederhole sich in Freuds Schrift über den Mann Moses, in der er sich der Frage widmete, wie sich die Rationalisierungsdynamik, die durch den von Moses gestifteten Monotheismus in Gang gesetzt wurde, in der Kultur des jüdischen Volkes habe befestigen können. Oevermann zufolge chiffriert Freud diese Dynamik, der er wie Weber eine weltgeschichtliche Bedeutung beimesse, als „Wiederkehr des Verdrängten“, in dem Fall der Verdrängung des Mordes an dem Religionsstifter Moses (ebd., S. XIV). In der Analogie der religiösen Weltgeschichte mit der Neurosenlehre wiederhole sich jedoch das Problem der neo-lamarckistischen Konstruktion: Schauplatz der Wiederkehr des Verdrängten können nicht diejenigen gewesen sein, die Moses möglichweise ermordet haben, sondern allenfalls spätere Generationen. Um dieses Problem näher zu beleuchten, verweist Oevermann auf die strukturgesetzliche Gemeinsamkeit zwischen der Mose-Tradition bzw. dem jüdischen Schöpfungsmythos, dem Ödipus-Mythos und dem ontogenetischen Entwicklungsprozess:
In allen diesen Fällen geht es darum, daß ein objektive Schuld bedeutendes Geschehen der Vorgeschichte angenommen wird, das subjektiv-ethisch nicht zurechenbar ist, das aber als lebensgeschichtlich konstitutives Geschehen nicht getilgt werden kann und zu irgendeiner rekonstruktiven Bearbeitung drängt, die nachträglich, aus der Perspektive des ethisch verantwortlichen Subjektes diese objektive Schuld in eine subjektive zu bearbeitende verwandelt (ebd., S. XV).
Auf der Basis dieser Annahme deutet Oevermann – mit Weber und gegen Freud, der diesen Schritt nicht konsequent vollzogen habe – die Entstehung des Monotheismus als eine entscheidende religionsgeschichtliche Kulturleistung. Indem Freud den phylogenetischen Übergang von der Natur zur Kultur durch ein neo-lamarckistisches Argument erkläre, habe er sich die Erkenntnis verstellt, dass es sich um eine strukturtransformatorische Rationalisierungstendenz handle (ebd., XVII; vgl. auch Riesman 1972, S. 138).
Freuds Mose-Buch ist ein auch für ein breiteres Publikum bestimmtes Buch eines Ägyptenbegeisterten und sollte auch als solches und als Kind seiner Zeit gewürdigt werden. Da Freud schon damals nicht auf dem Stand der historischen Forschung argumentierte, mit den einschlägigen Arbeiten von Ernst Sellin nicht konsensfähige Außenseiterpositionen adaptierte und der Spekulation weiten Raum gelassen hat, gelten seine Thesen für die historischen Fachwissenschaften als nicht ernsthaft diskutabel. Zudem ist die Studie als Auseinandersetzung Freuds mit der eigenen Herkunft zu werten (Rice 1990; Yerushalmi 1991). Das Buch ist zwar zu einem viel gelesenen Klassiker psychologischer Geschichtsdeutung geworden, ist aber substanziell heute kaum mehr als ein wissenschaftsgeschichtliches Dokument und primär für Freuds Werkgeschichte und Biografie von Bedeutung. Ob man Freuds Modell der „Wiederkehr des Verdrängten“ im Kontext von Theorien des kulturellen Gedächtnisses applizieren kann, bleibt aufgrund seines hoch spekulativen Charakters fraglich. Die Frage nach dem kulturellen Gedächtnis und seinen Mechanismen wird im Mann Moses eigentlich nicht berührt, sondern wird mit dem obsoleten Modell der Vererbung des Erworbenen begründet. Freuds Vereinnahmung für die Theorie des kulturellen Gedächtnisses beruht damit auf einem Missverständnis. Problematisch erscheint aus historischer Sicht insbesondere die Applikation individualpsychologischer Prozesse auf historische Ereignisse sowie die der Geschichtsdeutung zugrundegelegte Metatheorie des (ursprünglich totemistischen) urzeitlichen Vatermordes. Nicht weniger problematisch ist Freuds Postulat eines „jüdischen Schuldkomplexes“, da er hier ein antijüdisches Stereotyp im Rahmen seines Deutungsmusters aufgreift und theoretisch unterfüttert. Freuds Leistung kann – abseits der fachwissenschaftlichen Problematiken – jedoch darin gesehen werden, dass er die kulturelle Prägekraft religiöser Phänomene theoretisiert und in den Fokus der Betrachtung gerückt hat: So skeptisch Freud der Religion und ihren illusionären Elementen gegenüberstand, so hatte er doch Hochachtung vor dem „harten, kompromißlosen Monotheismus“, dessen geistiger Produktivkraft sowie der gemeinschaftsstiftenden Kraft von Religionen (vgl. Riesman 1972, S. 129 f., 134).
Notes
- 1.
- 2.
Freud benutzt für den Namen des Königs eine Variante der englischen Schreibweise: Ikhnaton.
- 3.
Bei Freud durchweg irrtümlich als Ed.[uard] Sellin zitiert.
- 4.
Die Konzeption der Genese Jahwes aus einem dämonischen Bergnumen wurde insbesondere von Paul Volz in seiner Studie Das Damönische in Jahwe (1924) in die Diskussion eingebracht. Freud scheint das Werk gekannt zu haben, zitiert es aber nicht.
- 5.
Zur Rekonstruktion dieses Problems vgl. Burkholz (1995).
Literatur
Assmann, J. (1998). Moses der Ägypter: Entzifferung einer Gedächtnisspur. München: Hanser (Erstveröffentlichung 1997).
Assmann, J. (2003). Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus. München: Hanser.
Assmann, J. (2015). Exodus: Die Revolution der Alten Welt. München: Beck.
Breasted, J. H. (1933). The dawn of conscience. New York: Charles Scribner’s Sons.
Burkholz, R. (1995). Reflexe der Darwinismus-Debatte in der Theorie Freuds. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.
Derrida, J. (1997). Dem Archiv verschrieben. Eine Freudsche Impression. Berlin: Brinkmann & Bose.
Freud, S. (1989a). Totem und Tabu (Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker) (Studienausgabe Bd. IX, S. 287–444). Frankfurt a. M.: Fischer (Erstveröffentlichung 1912–1913).
Freud, S. (1989b). Der Mann Moses und die monotheistische Religion: Drei Abhandlungen (Studienausgabe Bd. IX, S. 455–581). Frankfurt a. M.: Fischer (Erstveröffentlichung 1939).
Knoblauch, H. (1999). Religionssoziologie. Berlin: de Gruyter.
Matthes, J. (1967). Religion und Gesellschaft. Einführung in die Religionssoziologie (Bd. I). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Mayer, A. (2016). Sigmund Freud zur Einführung. Hamburg: Junius.
Oevermann, U. (1995). Vorwort. In R. Burkholz (Hrsg.), Reflexe der Darwinismus-Debatte in der Theorie Freuds (S. IX–XXI). Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.
Rice, E. (1990). Freud and Moses: The long journey home. Albany: New York State University Press.
Riesman, D. (1972). Freud und die Psychoanalyse (5. Aufl.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Sellin, E. (1922). Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte. Leipzig: Deichersche Verlagsbuchhandlung.
Volz, Paul. (1924). Das Dämonischen in Jahwe, SGV 100. Tübingen: Mohr & Paul Siebeck.
Yerushalmi, Y. H. (1991). Freud’s Moses: Judaism terminable and interminable. New Haven: Yale University Press.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2019 Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
About this chapter
Cite this chapter
Schmitt, R., Gärtner, C. (2019). Sigmund Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion: Drei Abhandlungen (1939). In: Gärtner, C., Pickel, G. (eds) Schlüsselwerke der Religionssoziologie. Veröffentlichungen der Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15250-5_22
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-15250-5_22
Published:
Publisher Name: Springer VS, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-658-15249-9
Online ISBN: 978-3-658-15250-5
eBook Packages: Social Science and Law (German Language)