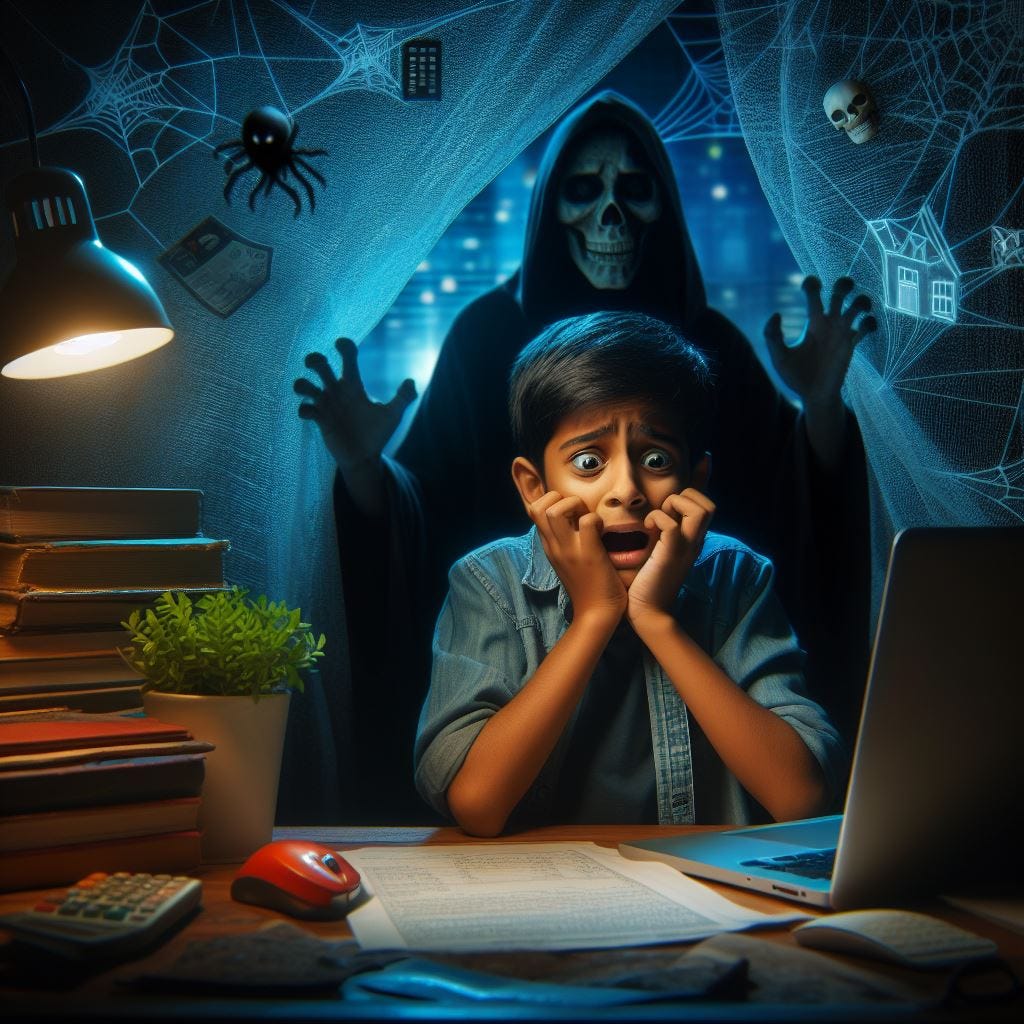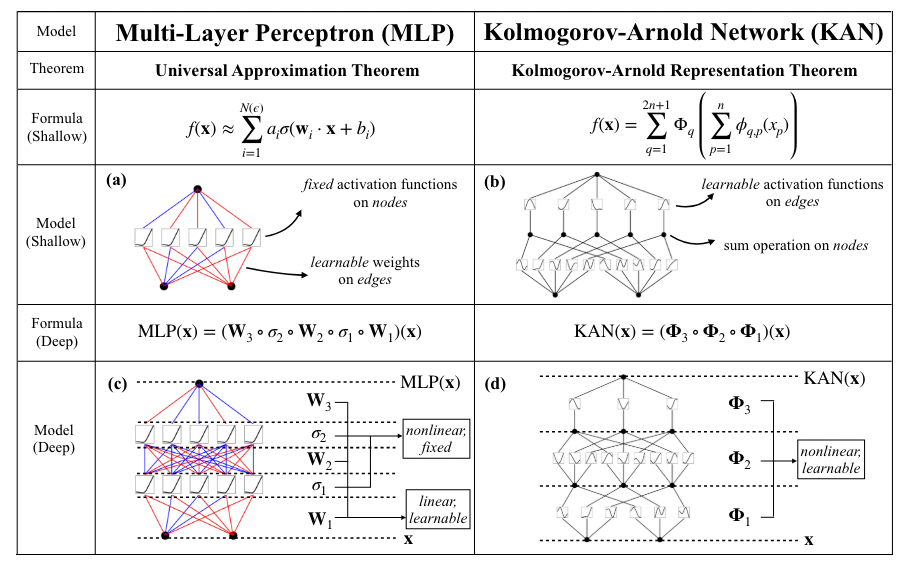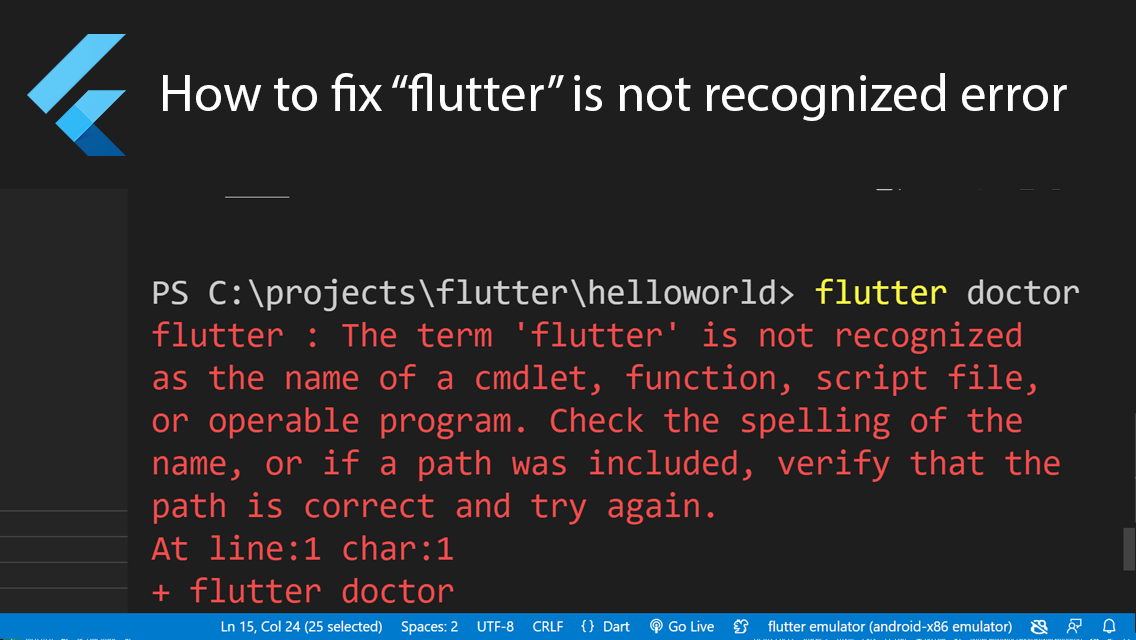Generationenwechsel: Wechsel in der Herausgeberschaft von Menschen — Zeiten — Räume
von Felix Schröder
Ich führe schon einige Jahre das Interview für das Cornelsen-Autor*innen-Magazin aber mit vier Interviewpartner/-innen zu sprechen ist auch für mich eine Premiere. Das hat seinen Grund: Sie vier gestalten einen Generationswechsel der Herausgeberschaft in der langjährigen Zusammenarbeit mit Cornelsen. Die Reihe Menschen — Zeiten — Räume gäbe es ohne Sie so nicht. Frau Köster, Herr Potente, Sie geben die Herausgeberschaft ab und haben einen langen Betrachtungszeitraum des Schulunterrichts. Welche drei Merkmale des Unterrichts haben sich Ihrer Meinung nach am stärksten verändert?
Elisabeth Köster: Stark verändert hat sich die Zielgruppe. Ein großer Teil der Schülerschaft, die in den Klassen der 1960er- bis in die 1980er-Jahre noch eine solide Basis bildete, ging der Hauptschule an die übrigen weiterführenden Schulformen verloren. Neu hinzu kamen viele Kinder mit Migrationshintergrund — vielfach mit lückenhaften Deutschkenntnissen und wenig Unterstützung durch das Elternhaus. Ferner haben sich die Aufmerksamkeitsdauer der Schüler/-innen und ihre Gewohnheiten bei der Aufnahme und der Verarbeitung von Informationen geändert.
Dieter Potente: Das weiß ich gar nicht so genau. Nach dem Willen der Schulpolitiker bzw. der Wissenschaft geht es ja immer um die Frage, was sich im Unterricht ändern sollte und was sich tatsächlich ändert. In meiner früheren Rolle als Qualitätsprüfer habe ich nicht sehr viele Veränderungen des Unterrichts erlebt.
Herr Humann, Herr Köhler, sind das auch Ihre Erfahrungen?
Wolfgang Humann: Zwei Dinge fallen mir sofort ein: Das ist zum einen die zügige Entwicklung im informationstechnologischen Bereich und der Ganztagsbetrieb. Es ist längst Normalität, dass Schulen recht gut mit Tablets ausgestattet sind. Schüler/-innen arbeiten damit im Klassenraum, auf dem Schulflur oder im Forum der Schule. Das Tablet ist aber sicher nicht die letzte Errungenschaft in der Schule. Aufgabe von Unterricht muss es sein, Schüler/-innen dabei zu helfen, kritisch mit dieser Technik zu umzugehen und nicht nur Konsumenten zu sein — das lernen sie schon schnell genug.
Zum anderen ist es das Ganztagsangebot. Bei jeder neuen Schulgründung gibt es dort direkt weiterführendes Angebot. Das bedeutet, dass nach dem Unterrichtsschluss die Schule wirklich zu Ende ist. Dann fällt mir etwas ein, was sich im Unterricht oder eher nach dem Unterricht nicht so sehr geändert hat: das Stöhnen der Lehrkräfte darüber, dass heutige Schüler/-innen im Gegensatz zu früher oft so wenig können, dass sie nicht lernen wollen usw.
Manuel Köhler: Selbstverständlich hat sich die Zielgruppe innerhalb eines Klassenverbandes verändert. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, die zu einem großen Teil erst seit einigen Jahren bei uns sind, haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz und Erlebnisse. Umgekehrt ist das natürlich genauso. Ich stelle in der Unterrichtsarbeit zudem fest, dass vor allem politische und historische Themen zunehmend weniger außerhalb der Schule thematisiert werden.
Lehrpläne geben den inhaltlichen Rahmen von Unterricht vor und auch den materiellen, was die mediale Form der Inhalte angeht. Welche Innovation haben Sie für die Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften besonders begrüßt? Und welche sehen Sie kritisch — Stichwort ChatGPT und Künstliche Intelligenz?
Elisabeth Köster: Gerade in der Hauptschule sind handlungsorientierte und praxisbezogene Elemente wichtig. Besonders begrüßt habe ich daher die Einführung des Faches Arbeitslehre Wirtschaft. Sehr gut finde ich auch die Akzentuierung der Berufsorientierung u.a. mit Betriebspraktika oder Simulationen im Unterricht. Im Hinblick auf die manipulativen Möglichkeiten der KI sollten die Schüler/-innen Gelegenheit bekommen, sich selbst erst einmal z.B. mit ChatGPT vertraut zu machen. Im Fach Geschichte scheitern einprägsame Dinge oft am Zeitmangel. So z.B. Unterricht vor Ort mit eigenen Dokumentationen oder Museumsunterricht mit Erstellen von Erschließungsmedien.
Dieter Potente: Ich sehe es als Fortschritt an, dass die meisten Bundesländer inzwischen die Fächer Geschichte, Politik und Erdkunde zum Fachbereich Gesellschaftslehre zusammengefasst haben. Wichtig finde ich auch, dass in vielen Lehrplänen stärker auf die europäische, anstatt nur auf die nationale Dimension geschaut wird. Als kritisch sehe ich es an, dass es in der Gesellschaftslehre offenbar nicht genügend gelungen ist, die Vorzüge unserer demokratischen, liberalen Gesellschaftsordnung deutlich zu machen. Aber das ist nicht nur ein Problem der Schule, der Schulbücher, sondern der ganzen Gesellschaft.
Wolfgang Humann: Moderne Lehrpläne geben nicht mehr nur Inhalte vor, sondern zielen auf Fragestellungen im Zusammenhang mit Inhalten. Diese Fragen sind auf die Welt gerichtet, in der wir leben. Das ist natürlich nicht ganz neu. Auch vor 30 Jahren wurden nicht einfach Inhalte vermittelt. Es geht schon längere Zeit um Probleme und Fragestellungen zu bestimmten Inhalten. Die Entwicklung in diesem Bereich wird weitergehen. Wir betrachten Inhalte heute anders als vor 30, 20 oder 10 Jahren und wir werden diese Inhalte später anders betrachten als wir das heute tun. Und so verändern sich auch unsere Fragen — und eben auch die Lehrpläne.
KI spielt nach meiner Einschätzung bei jüngeren Schüler/-innen bisher noch keine so bedeutende Rolle. Das kann sich aber schnell ändern. Ich glaube nicht, dass da Referate abgegeben werden, die mithilfe von KI erstellt wurden und keiner merkt das. Ein Referat wird vorgetragen und es gibt Nachfragen, auch von Seiten der Lehrenden. Da fliegt ein Täuschungsversuch schnell auf. Es sollte gelingen, diese Technik sinnvoll zu nutzen. Was spricht dagegen, wenn Schüler/-innen sich mithilfe von KI Informationen beschaffen und damit arbeiten?
Manuel Köhler: Ich begrüße es ebenfalls, dass Geschichte, Politik und Geographie zu einem Fächerverbund zusammengefasst wurden. Vieles ist einfach nicht zu trennen und greift ineinander. Wünschenswert wäre es, wenn man mehr Zeit für dieses Fach hätte und die notwendigen Ressourcen, um wichtige Inhalte noch häufiger außerhalb der Schule an historischen oder „realen“ Lernorten zu veranschaulichen.
Frau Köster, Herr Potente, mit welchem Gefühl geben Sie die Herausgeberschaft ab? Sind Sie zufrieden mit dem Erreichten? Oder ist etwas „nicht fertig geworden“ — wenn das Fertigwerden überhaupt geht?
Elisabeth Köster: Bücher haben ihre Grenzen und rufen nach der Ergänzung durch andere Medien. Trotzdem war ich mit der Arbeit an diesem Medium immer zufrieden. Wir hatten Gelegenheit, neue Wege zu gehen und man darf gespannt sein, wie sich das Medium Schulbuch künftig behauptet!
Dieter Potente: Wenn wir nicht alle zusammen das Gefühl gehabt hätten, bei Cornelsen gute Produkte zu schaffen, hätte unsere gute Zusammenarbeit sicher nicht so lange funktioniert. Aber die Frage der Bildrechte und Lizensierungen war für uns in den letzten Jahren ein zunehmendes Problem, denn oft landeten aus rechtlichen Gründen eben nicht die Bilder im Buch, die wir als Autoren gerne gesehen hätten.
Wie fühlt es sich für Sie Herr Humann, Herr Köhler an, in diese neue Rolle zu kommen? Sie vier haben ja bereits lange als Team zusammengearbeitet.
Wolfgang Humann: Ganz so neu ist die Rolle des Herausgebers nicht. Wir arbeiten seit Jahren im Herausgeberteam zusammen.
Manuel Köhler: Die Fußstapfen sind natürlich groß. Aber letztendlich geht es darum, ein gutes und im Unterricht praktikables Buch immer weiterzuentwickeln und mit Leben zu füllen. Dies haben mir Elisabeth Köster und Dieter Potente immer wieder ans Herz gelegt. Und diesen Weg versuche ich im Sinne der Kollegen weiterzugehen.
Wolfgang Humann, Jahrgang 1964, ist Hauptschullehrer für Erdkunde, Geschichte und Gesellschaftslehre in Dülmen und Dozent für DaF
Manuel Köhler, Jahrgang 1976, ist Mittelschullehrer in Schweinfurt und unterrichtet eine Vielzahl von Fächern in unterschiedlichen Jahrgangsstufen.
Dr. Elisabeth Köster, Jg. 1940, Studium Geschichte, Deutsch u. Wirtschaftswissenschaften, Promotion zum Dr. Päd. (Geschichte, Museums- u. Medienpädagogik, Lernpsychologie), ehemalige Lehrerin für Kfm. Schulen u. Hauptschulen, Lehrauftrag Uni Bonn für Medienpädagogik, Lehrerfortbildung.
Dr. Dieter Potente, Jahrgang 1949, ehemaliger Hauptschulleiter und Schulrat und Dezernent bei der Bezirksregierung Münster