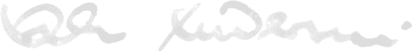Leben & Werdegang
Der Glatzköpfige mit seinen weit aufgerissenen Augen, seinem Oberlippenbärtchen und seiner dauerpikierten Stockschnupfenstimme ist bekannt von zahllosen Bühnenauftritten und aus über 280 Filmen: von Kino-Klassikern („Das Mädchen Rosemarie“, „Eins, zwei, drei“) bis hin zu Klamauk-Klamotten („Otto ist auf Frauen scharf“, „Wenn die tollen Tanten kommen“, „Charleys Onkel“). Besonders seine häufigen Darstellungen preußischer Zack-zack-Kommandeure, wie in Günter Neumanns „Schwarzem Jahrmarkt“ oder Kurt Hoffmanns „Wirtshaus im Spessart“, waren so überzeichnet wie legendär. Weniger bekannt dürfte sein, dass Hubert von Meyerinck – Hubsi, wie ihn seine Freunde nannten – aus Potsdam stammte. Am 23. August 1896 wurde er in der alten Garnisonstadt in eine Offiziersfamilie hineingeboren.
„An meinen Großvater, den früheren Kommandeur der roten Gardehusaren in Potsdam, erinnere ich mich nur noch schwach. Ich heiße nach ihm Hubert… Damals gab die Garde den Ton an und ihre Damen mit den hochfrisierten Haaren, die im Park von Sanssouci in die Knie sanken, wenn die Prinzessinnen vorbeifuhren oder gar der Kaiser.“
„Das hochmütige Potsdam… in dem ich geboren und in einem Kinderwagen aus Hirschgeweihen herumgefahren worden war, einem entsetzlichen Monstrum, das meine jagdverrückten Onkel meiner Mutter geschenkt hatten und an dem sich meine Kindermädchen die Schürzen zerrissen.“ In diesem Kinderwagen aus Hirschgeweihen hatte man den Sprössling bereits in die Kirche gefahren, wo er auf die klingenden 4 Vornamen Hubert Georg Werner Harald evangelisch getauft wurde.
-
 „Er hat sich selbst dessen nie gerühmt, aber in der Kristallnacht ist er über den Kurfürstendamm gelaufen und hat gerufen: ‚Wer auch immer unter Ihnen jüdisch ist, folgen Sie mir.‘ Er hat die Leute in seiner Wohnung versteckt. Ja, es hat sie gegeben, die anständigen Menschen, deren Worten man glauben konnte, dass es schwierig war, Widerständler zu werden in jener Zeit. Menschen wie Meyerinck waren herrlich, wunderbar“, erzählte Filmproduzent Billy Wilder 1997 dem SPIEGEL über den gebürtigen Potsdamer Hubert von Meyerinck.
„Er hat sich selbst dessen nie gerühmt, aber in der Kristallnacht ist er über den Kurfürstendamm gelaufen und hat gerufen: ‚Wer auch immer unter Ihnen jüdisch ist, folgen Sie mir.‘ Er hat die Leute in seiner Wohnung versteckt. Ja, es hat sie gegeben, die anständigen Menschen, deren Worten man glauben konnte, dass es schwierig war, Widerständler zu werden in jener Zeit. Menschen wie Meyerinck waren herrlich, wunderbar“, erzählte Filmproduzent Billy Wilder 1997 dem SPIEGEL über den gebürtigen Potsdamer Hubert von Meyerinck.
Kindheit in Potsdam und Posen
Die dreiköpfige Familie um Friedrich-Carl von Meyerinck (1858–1928), der im Potsdamer Gardejäger-Bataillon vom Leutnant zum Hauptmann aufgestiegen war, musste nichts entbehren: sie hatte Diener, Kutscher, Jäger, sie war adlig und begütert.
Huberts freidenkende und uneitle Mutter Caroline von Hoppenstedt (1868–1940) stammte ursprünglich aus Hannover. Sie litt unter dem erzkonservativ-preußischen Leben in der Garnisonstadt und atmete auf, als ihre Jahre in Potsdam kurz nach der Jahrhundertwende mit einem Paukenschlag endeten: Aus reinem Affekt heraus hatte ihr Gatte militärisch Abschied genommen. Vor der versammelten Front seines Bataillons auf dem Bornstedter Feld war er mit dem Pferde umgekehrt und davongaloppiert, nur weil er sich über das Verhalten eines Kommandeurs wiederholt geärgert hatte.
Kurzerhand zog die Familie von Potsdam aufs Familiengut Kiewitz in der Provinz Posen. Doch auch dort litt die Mutter – allerdings unter ihrem Gatten. Die Probleme saßen also tiefer. „Die Ehe meiner Eltern war unglücklich, sie passten nicht zueinander; sie in ihrer äußeren und inneren Zartheit, er in seiner strahlend schönen, gewalttätigen Männlichkeit… jähzornig und grundgut… Ich habe meine Mutter geliebt und meinen Vater gefürchtet.“ Hubert war 12jährig, als seine Eltern sich endlich scheiden ließen. „Mein Gott, es gab damals, besonders in der Aristokratie, so viele unglückliche Ehen! ‚Die Ehe wurde unglücklich.‘ Dies war ein geflügeltes Wort um die Jahrhundertwende.“ Die Mutter nahm den Sohn und zog nach Berlin.
Bohémien in Berlin
Nach nur kurzem Militärdienst im I. Weltkrieg wurde er wegen eines Lungenleidens entlassen. Er nutzte die Gelegenheit und nahm Schauspielunterricht. Danach begann er 1917 als Volontär am Berliner Königlichen Schauspielhaus. „Von meiner Mutter habe ich wohl die Begabung fürs Theater geerbt, die Zügellosigkeit von meinem Vater.“ Es folgte ein Engagement bei den Hamburger Kammerspielen, und 1921 kehrte er in die Hauptstadt zurück. Nebenbei schrieb er Gedichte – diesem Zeitvertreib blieb er bis in seine letzten Lebensjahre treu, doch nur ein einziger Gedichtband wurde veröffentlicht: Er erschien 1922 unter dem eigenwilligen Titel „Lider im Abend“.
Hier in Berlin spielte Meyerinck nicht nur auf der ernsten Theaterbühne unter Max Reinhardt, sondern auch in dessen Kabarett „Schall und Rauch“ oder für Friedrich Hollaenders Kleinkunstbühne „Tingel-Tangel“. In diesem Berlin der Weimarer Republik gab er gern und oft überspannte Dandys, Snobs oder androgyne Wesen zum besten. Populär in dieser Zeit waren seine Duette mit Marlene Dietrich (Revue „Es liegt in der Luft“) oder auch seine Electrola-Schallplattenaufnahme „Ich war nie mit Lilli allein“, die ihm bis in die 1950er Jahre hinein, allerdings mit wechselnden Frauennamen, des öfteren nachgesungen wurde.
Auf dem 50. Geburtstag des Kunsthändlers Alfred Flechtheim tanzte und sang er als Spanierin verkleidet. „Mir wird heute noch schwindlig, wenn ich daran denke. Aber zu dieser Zeit fand man solche Szenen amüsant.“ Einen ‚extatischen Expressionisten‘ mimt er auf einem Salon-Abend vor Innenminister Wolfgang Heine, vor Diplomaten und Schauspielern sogar splitterfasernackt. Meyerinck ist ganz Bohémien geworden, lebensdurstig und selbstbewusst. Und er spielt sich frei vom Druck soldatisch-gutsherrlicher Traditionen. „Mein Beruf, den mein Vater noch sehr klar miterlebte, war ihm ein Greuel.“ Gerade das Exaltierte und Extravagante lag Hubsi.
Privat liebte er es ebenfalls, in Berlin ‚auf Sause‘ zu gehen – er zog allein oder mit Freunden die ganze Nacht durch die Berliner Halbwelt. Am Ende solch einer Sause fehlte ihm immer der nötige Schlaf, meist aber auch die Brieftasche, die Ringe, die Armbanduhr. Seine sehr persönlichen Schilderungen über das Nachtleben jeder Zeit, dessen edle und unedle Protagonisten, dessen drastische Veränderungen nach 1933 und deren Schicksale über das Jahr 1945 hinaus hat er in seinen Memoiren festgehalten. Zehnmal wurden sie aufgelegt.
Licht und Schatten
Die berühmtesten Schauspielerinnen alter Berliner Garde zählte Meyerinck zu seinen Engvertrauten: Adele Sandrock, Elsa Wagner, Grete Mosheim, Henny Porten, Elisabeth Bergner, Käthe Dorsch und viele andere. (Nicht umsonst heißt das Erinnerungsbuch gegen Ende seines Lebens „Meine berühmten Freundinnen“ und ist ihnen gewidmet.) Sogar in den sapphischen Berliner Bars vor 1933 war Hubsi bei den Frauen Hahn im Korbe – was neben ihm keinem anderen Mann zugebilligt wurde, wie uns Regisseur Géza von Cziffra in seinen Erinnerungen über Marlene Dietrich und Claire Waldoff überliefert hat.
Solche Zuneigung flog Meyerinck von Seiten der Zuschauer nicht immer entgegen. Denn durch den Film waren ihm meist Rollen als abgefeimter Bösewicht oder zwielichtiger Halbseidener zugedacht. „Ein ganz infamer Bursche! Quatschkopf, Gangster, Reaktionär, Schieber, Hochstapler! Pfui Spinne! Man sollte diesem albernen Fatzken eine kleben! Das ist nur ein kleiner Spiegel der Gefühle, die ich laut Vertrag in meinem geliebten Publikum wachrufen muss.“
Durch die fast pausenlose Arbeit bei der UFA in Babelsberg blieb er zwar stets indirekt mit Potsdam verbunden, aber nur der Film „Das Flötenkonzert von Sanssouci“ (1930) brachte ihn auch motivisch noch einmal nach Potsdam zurück. Ansonsten verband er mit dem ‚alten Havelnest‘ nur die Abneigung seiner Mutter – oder er erinnerte sich daran, dass z.B. seine Cousine Klara Karoline Erika, Gräfin von der Schulenburg, im Herbst 1945 hier buchstäblich verhungert war.
Zu den Filmen, die unter Meyerincks Mitwirkung im ‚Dritten Reich‘ entstanden, gehören auch heute sogenannte Vorbehaltsfilme, also Propagandastreifen: von „Henker, Frauen und Soldaten“ (1935), einem Lobgesang auf die Freikorps, über „Trenck, der Pandur“ (1940), antifranzösischer Soldatenromantik, bis hin zu „Die Rothschildts“ (1940), antisemitisch und antibritisch, oder „Venus vor Gericht“ (1941), gegen jüdischen Kunsthandel.
Einer der Muntersten
Hervorzuheben aber ist sein charaktervolles Verhalten in der Nazizeit. Kurt von Ruffin hat dies eindrücklich in einem Interview („Als schwuler Häftling in den KZs Columbiahaus und Lichtenburg“ 1978/1991) beschrieben: Meyerinck lebte offen homosexuell („Er war ja einer der muntersten!“), geriet mit den herrschenden Sittengesetzen und Vollzugsgewalten in Konflikt – trotzdem begleitete er immer wieder Freunde und Kollegen zum Polizeirevier am Alexanderplatz oder zur Gestapo in der Brüderstraße. Einfach um ihnen menschlich oder finanziell beizustehen.
Es ist daher nicht übertrieben, wenn der Verlag, der sein schmales Memoirenbändchen 1966 herausgab, zu ihm klappentextete: „Viele seiner Freunde wurden in der Hitlerzeit verfolgt. Die selbstverständliche Art, wie er ihnen damals beistand, erklärt vielleicht am besten, warum Meyerinck so ungewöhnlich viele – berühmte und nicht berühmte – Freunde besitzt.“
Seinen Freimut und die Bestimmtheit, mit der er sich zu seiner Lebensweise bekannte, legte er auch in späteren, heimatfilmseligen Zeiten nicht ab: „Ich liebe blonde, aristokratische Frauen, aber schlafen kann ich nur mit ordinären Matrosen“, gestand er z.B. dem Schauspieler Curd Jürgens ganz offen. Gleichzeitig gelang es ihm, Einzelheiten seines Privatlebens aus der klatschhungrigen bundesrepublikanischen Presse herauszuhalten.
„Spiel jeden Quatsch, den du kriegen kannst!“
Meyerincks künstlerische Heimat blieb immer das Theater. Dort billigte man ihm zu, ohne die Schablone des einseitigen Ganoven und Widerlings auszukommen, und bot ihm Charakterrollen: neben Mephisto verkörperte er den Malvolio, den Riccaut, den eingebildeten Kranken, den Polonius, den Marinelli, den Grafen Orlofski oder den Mackie Messer.
Hörfunk und Schallplatte nutzten vorwiegend seine kabarettistische Stimmbegabung. Bereits 1947 war er in den Funkmatineen des RIAS und bei Günter Neumann zu hören, sowie (erst recht nach seinem Umzug 1950 von Berlin nach München) auf allen süd- und westdeutschen Sendern in Kabarettformaten. Auch die Schallplattenreihe „Literarische Kleinkunst“ der Deutschen Grammophon-Gesellschaft brachte zwischen 1963 und 1967 gelungene Veröffentlichungen mit ihm heraus – wo er teilweise auch Selbstgedichtetes wieder unterbringen konnte („O frivol ist mir am Abend“, 1963).
Für seine eigentliche Breitenwirkung und Bekanntheit jedoch sorgten bis heute seine zahllosen Film- und Fernsehrollen. Die Filmproduktion der frühen und späten Wirtschaftswunderzeit schien für einen alternden Schauspieler nur Schubladen bereitzuhalten, mit denen dieser sich eben zu arrangieren hatte, wollte er im Gespräch und im Geschäft bleiben:
Ob versnobte Adlige, blasierte Offiziere, nervöse Staatsbeamte oder sonstige exaltierte Chargen – auf Schrulle und Verschrobenheit wurde Meyerinck festgelegt.
Hervorzuheben hier natürlich die Paraderolle als preußischer Obrist und aller seiner Nachfahren („Zack zack!“) in den drei Filmen: „Das Wirtshaus im Spessart“, „Das Spukschloss im Spessart“ und „Herrliche Zeiten im Spessart“. Der Oliver-Kalkofe-Generation dagegen dürfte Meyerinck mit seiner Darstellung des Chefs von Scotland Yard in den fünf Edgar-Wallace-Filmen 1965 bis 1969 noch gut vor Augen sein.
„Spiel jeden Quatsch und Mist, den du kriegen kannst“, hatte ihm Schauspielkollege Theo Lingen zum Erhalt der Popularität als Motto anempfohlen. Und tatsächlich: Würden uns die Theaterspielpläne zwischen 1968 und 1971 nicht verraten, in welch ernstzunehmenden Rollen Meyerinck vor ausverkauften Reihen stand (z.B. ganz zuletzt im Hamburger Thalia-Theater als Agamemnon in „Die schöne Helena“ von Peter Hacks), so könnte man meinen, Meyerinck wäre künstlerisch inzwischen ins Peinliche abgerutscht.
Lieder wie „Das Päderast-Haus im Spessart“ oder „Komm in den Striptease-Schuppen“ – beide auf der LP „Des alten Knaben Wunderhorn“, wo auch Chris Howland oder Edith Elsholtz musikalische Reimereien auf der Höhe von Herrenwitzen hören lassen – sind einfach Versuche, als gealterter Schauspieler mit der sogenannten Sexwelle Anfang der 1970er Jahre und mit seiner einmal etablierten Filmcharakter-Schublade noch etwas Kasse zu machen.
Solch ein Versuch ist wohl auch das Album „Selten so jelacht! Zack zack“ (1966), das parallel zur Spessart-Film-Trilogie kommerziell noch den letzten Saft aus Meyerincks so beliebter Karikatur preußischer Militärs pressen wollte. Amüsant ist an dieser, völlig aus der Zeit gefallenen Folge von Militärwitzen heute nichts mehr. Um noch als Seitenhieb auf das personelle Erbe der jungen Bundeswehr aus Reichswehr und Wehrmacht zu gelten, erschien die LP zu spät.
An Auszeichnungen ist Hubert von Meyerinck schon zu Lebzeiten nicht arm gewesen, u.a. wurde ihm 1960 der Preis der Filmkritik, 1967 der Bambi und 1968 das Filmband in Gold (Bundesfilmpreis) verliehen. Am 13. Mai 1971 starb er in Hamburg: Nachdem er einen Herzinfarkt überwunden hatte, zog er sich im Hamburger Bethanien-Krankenhaus eine Lungenentzündung zu und erlag plötzlichem Herzversagen. 1994 gab Berlin-Charlottenburg dem Meyerinck-Platz ihm zu Ehren seinen Namen. Ein Meyerinck-Weg hingegen, den es vor 1945 in Glienicke gegeben hatte, war nicht nach ihm, sondern nach seinem Großvater benannt – dem Potsdamer Generalleutnant und Militärschriftsteller.
Autor: M. Deinert – Dieser Text erschien mit leichten Änderungen abgedruckt im Kultur- und Gesellschaftsmagazin für das Land Brandenburg, potsdamlife, Heft 44 (=2/2016), S. 68–71.
Sendungsnachweis
| Datum | Sender | Land | Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HÖRFUNK: 1947 | Berliner Rundfunk (Radio Berlin) | SBZ | unbek. - unbek. | HÖRSPIEL: Das alte Puppenspiel vom Doktor Faust | Regie: Carlheinz Riepenhausen | |
| Film: DER MÜDE THEODOR | ||||||
| Film: DER STERN VON SANTA CLARA | ||||||
| Film: DER VERKAUFTE GROSSVATER | ||||||
| Film: MELODIE UND RHYTHMUS | ||||||
| Film: DANY, BITTE SCHREIBEN SIE | ||||||
| Film: WENN DIE MUSIK SPIELT AM WÖRTHERSEE | ||||||
| Film: OTTO IST AUF FRAUEN SCHARF | ||||||
| Film: DR. MED. FABIAN - LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN |
ARD retro

06.12.1962 ∙ BR Retro ∙ BR Fernsehen |
Margot Hielscher in Minute 0:27 und ab Minute 9:07 | Heidi Brühl ab Minute 0:28 und 0:53 | Grethe Weiser in Minute 0:41 und ab Minute 9:07 | Maria Schell in Minute 0:47, ab Minute 3:13 und in Minute 5:55 | Dieter Hildebrandt ab Minute 2:12 | Hubert von Meyerinck in Minute 4:08 und ab Minute 9:07 | Monika Grimm ab Minute 5:12 | Lale Andersen ab Minute 5:57 | Vico Torriani ab Minute 7:50 | im Hintergrund das Orchester Max Greger |
Titelnachweis
Quellen
- Mann für Mann. Biographisches Lexikon zur Geschichte von Freundesliebe und mannmännlicher Sexualität im deutschen Sprachraum. Hrsg. von Bernd-Ulrich Hergemöller. (2 Bände) Lit: Berlin & Münster 2010.
- Als schwuler Häftling in den KZs Columbiahaus und Lichtenburg 1935/36. Winfried Kuhn interviewt Kurt von Ruffin im Herbst 1978 in Berlin. In: CAPRI. Zeitschrift für schwule Geschichte. Nr. 13 (Heft 1991/03), S. 4–10.
- Géza von Cziffra: Kauf dir einen bunten Luftballon. Moewig: München [eigtl. Rastatt] 1982.
- Hubert von Meyerinck: Meine berühmten Freundinnen. (3. Auflage) dtv: 1971. (Reihe: dtv-Taschenbücher, Nr. 611)
- Hörzu (1948/45), S. 16