Kapitel
Das heutige Theater ist ohne das antike griechische Drama nicht denkbar. Sie markierten den Übergang von Ritualen zu geprobten Aufführungen mit Schauspielern.
Auch der Aufbau moderner Theaterstücke, Literatur und Filmen orientiert sich häufig an den Prinzipien der antiken Dramen. Diese Prinzipien wurden von dem Universalgelehrten Aristoteles beobachtet und in der Poetik beschrieben.
In diesem Artikel erfährst Du alles über das griechische Drama in der Literatur der Antike, seine Entwicklung, den Unterschied zwischen Tragödie und Komödie, die Inhalte und Struktur. Zum Schluss werden wir auf die Antigone des Sophokles eingehen, die als beispielhafte antike Tragödie gesehen werden kann.
Kommst du im Deutschunterricht nicht mehr richtig mit? Auf Superprof findest du für jede Stufe und jedes Fach den passenden Nachhilfeunterricht. Ein Beispiel Nachhilfe 2. Klasse Deutsch vielleicht für ein kleines Geschwister?

Die Entstehung des antiken griechischen Dramas
Einmal jährlich wurden im antiken Griechenland (ab dem 6. Jahruhundert v. Chr.) sechs Tage lang ein Fest zu Ehren des Dionysos, Gott des Weins und der Ekstase, veranstaltet; die Dionysien. Während dieser Zeit wurden alle Moralvorstellungen fallengelassen und ausschweifend gefeiert.
Zu den religiösen Zeremonien, die während der Dionysien abgehalten wurden, gehörten Opferrituale, ekstatische Tänze, Maskenumzüge und Chorgesänge, in denen Dionysos gepriesen wurde. Die Sänger waren dabei als Satyrn verkleidet. Satyrn sind lüsterne Waldgeister mit menschlichem Körper und tierischen Merkmalen, meist Bocksbart, -hufen und -hörnen, die zu den ständigen Begleitern des Dionysos gehören.
Im Jahr 534 v. Chr. stellte der Dichter Thespis zum ersten Mal dem Chor einen einzelnen Schauspieler gegenüber, der die Maske eines Menschen trug und mit dem Chor der Satyrn in einen Dialog trat. Dies gilt als die Geburtsstunde der ersten griechischen Tragödie.
In der Folge machten sich immer mehr Dichter daran, Tragödien zu schreiben und die Form weiter zu entwickeln, sowohl in der Textgrundlage als auch in der Darstellung. Die Aufführungen wurden immer aufwändiger, sodass feste Theater gebaut wurden. Die neuen Dramentexte waren nicht mehr nur Lobgesänge auf Dionysos, sondern bedienten sich an den Geschichten der antiken griechischen Sagen.
Die Aufführungen während der Dionysien in Athen waren immer auch ein Wettbewerb. Drei Dramatiker traten gegeneinander an und zeigten jeweils eine Tetralogie aus drei Tragödien und einem Satyrspiel, eine „scherzhafte Tragödie“, bei dem die Inhalte der gezeigten Tragödien aufgegriffen und parodiert wurden.
Aus dem Satyrspiel entwickelte sich die dritte Form des antiken Dramas: die Komödie. Anders als das Satyrspiel macht sich die Komödie nicht über Götter lustig, sondern über die Menschen und ihre alltäglichen Probleme. Neben den Tragödienwettbewerben wurden i Athen bald auch eigene Komödienwettbewerbe durchgeführt.
Die wichtigsten Dramatiker der griechischen Antike sind die Tragödiendichter Aischylos, Sophokles und Euripides und der Komödiendichter Aristophanes.
Raucht dir im Deutschunterricht regelmäßig der Kopf? Schau dich doch nach Unterstützung für Online Nachhilfe Deutsch um!

Aristoteles Tragödientheorie in der Poetik
Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. hatte sich schließlich eine feste literarische Form der Tragödie herausgebildet. Ab dieser Zeit erlebte das griechische Drama seine Blütezeit, die knapp hundert Jahre andauerte.
Der Universalgelehrte, Philosoph und Naturforscher, Aristoteles verfasste im 4. Jahrhundert v. Chr. seine Theorie der Dichtung, die Poetik. Darin beschreibt er sehr genau die Geschichte, den Aufbau und die Wirkung des antiken Dramas.
Dabei handelt es sich um Beobachtungen, die rückblickend gemacht wurden. Aristoteles Schrift hatte also keinen Einfluss auf die Entwicklung des antiken Theaters selbst, wird aber bis heute als Grundlage zur Analyse der alten Texte der antiken Literatur und hat die neuzeitlichen Literatur-Theorien und Theater-Formen beeinflusst.
Mimesis
Einer der zentralen Begriffe in der aristotelischen Poetik ist die Mimesis; die Nachahmung der Wirklichkeit. Aristoteles geht davon aus, dass jeder Mensch einen angeborenen Nachahmungstrieb hat, der ihm das Lernen ermöglicht und das die Menschen sehr viel Spaß am Nachahmen haben und dabei auch gerne Dinge darstellen, die wir in der Wirklichkeit ungerne sehen.
Laut Aristoteles ist jede Form von Literatur eine Nachahmung der Wirklichkeit; denn es wird etwas erzählt, dass wahrscheinlich so geschehen könnte. Im Gegensatz dazu sieht er die Geschichtsschreibung, die detailliert aufzeichnet, was tatsächlich geschehen ist.
Die Dichtung kann somit Fragen stellen und reflektieren, wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten sollte, ohne dass diese jemals eingetreten ist.
In der Komödie werden die menschlichen Schwächen übertrieben dargestellt und ins Lächerliche gezogen. Die Zuschauenden lernen durch Lachen und Spotten über die Figuren. In der Tragödie hingegen treten Menschen auf, die edel handeln, aber ihrem vorherbestimmten Schicksal nicht entgehen können.
Katharsis
Durch die Tragödie sollen die Zuschauenden aufgewühlt werden und „Furcht und Mitleid“ (oder je nach Übersetzung auch „Jammer und Schauder“) empfinden. Das soll dadurch geschehen, dass ein Held gezeigt wird, mit dem sich die Zuschauenden identifizieren können und der im Laufe der Handlung ins Unglück stürzt.
Indem man sich mit ihm mitleidet, kommt es, laut Aristoteles Tragödientheorie, zu einer Reinigung von diesen Emotionen: der Katharsis.
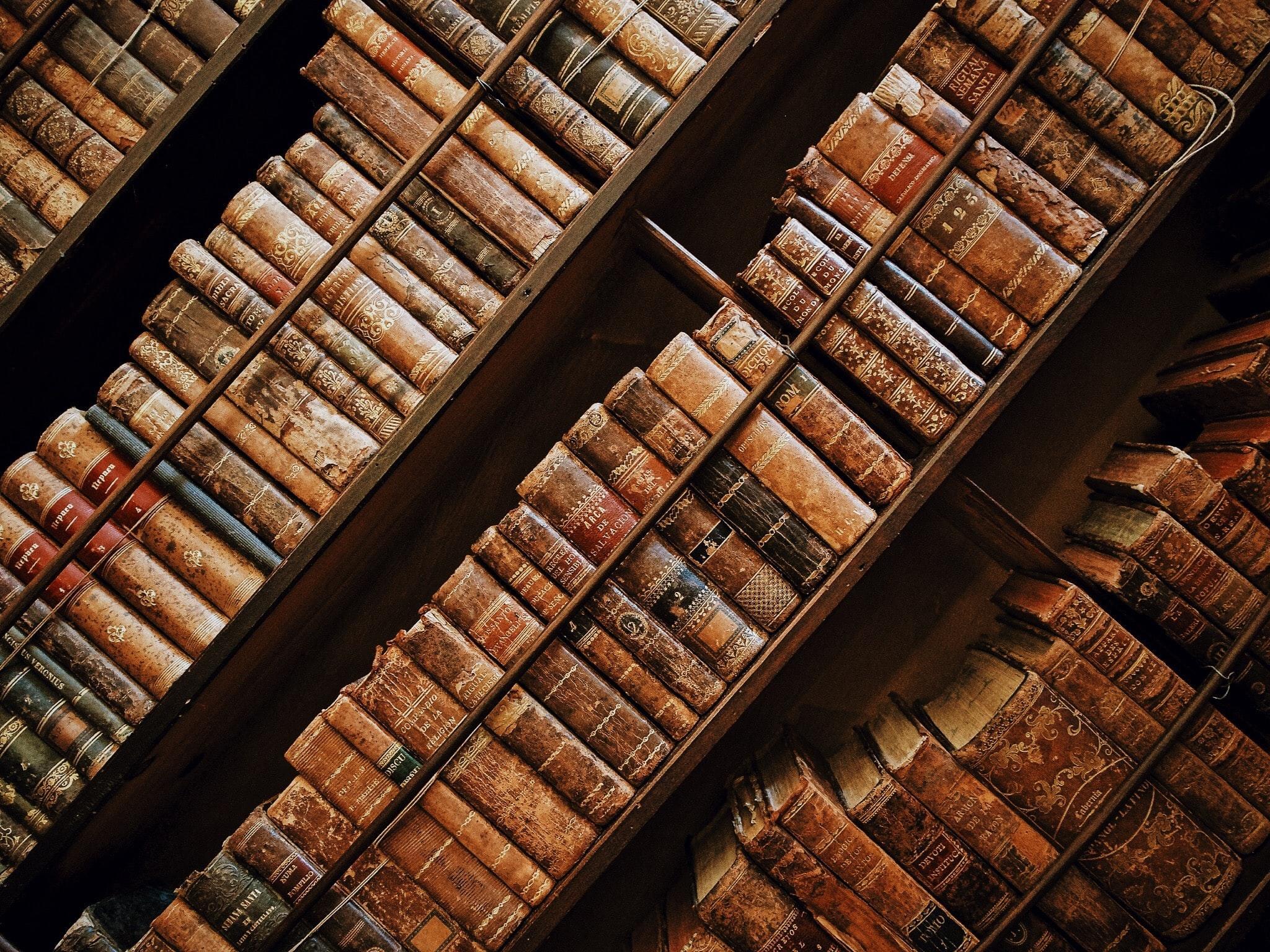
Inhalte der griechischen Tragödien
In den antiken Tragödien werden philosophische, religiöse und existentielle Fragen behandelt. Die meisten Geschichte stammen aus der Mythologie und erzählen, wie die Helden durch das Wirken der Götter oder ein vorbestimmtes Schicksal „schuldlos schuldig“ werden.
Es kommt zu einer Gegenüberstellung von:
- Mensch und Götter
- Schuld und Sühne
- Individuum und die Welt
- Charakter und Schicksal
Die Konflikte sind nicht immer durch menschliches Handeln zu lösen; eine Gottheit muss eingreifen, um die Handlung zum Abschluss zu bringen. Im antiken Theater geschah das durch eine Hebemaschine, die die Gottheit über die Bühne schweben oder auf dem Bühnendach landen ließ. Diesen oft überraschenden Auftritt nennt man Deus ex Machina (dt.: Gott aus einer Maschine).
Aufbau und Struktur der griechischen Tragödien
In der antiken Tragödie standen sich ein Chor aus 12 bis 15 Mitgliedern und zwei bis drei Schauspieler gegenüber. Der Chor hat die Funktion des Erzählers. Er beschreibt, kommentiert und teilt die Entscheidungen der Götter mit.
Die Schauspieler verkörpern die verschiedenen Figuren der Tragödie und treten in Dialog, untereinander oder mit dem Chor, und halten Monologe. Damit die Zuschauer die verschiedenen Rollen auseinanderhalten können, tragen sie Masken.
Die antiken Tragödien hatten einen strengen Aufbau, der nicht verändert werden konnte. Zu Beginn wurden teilweise in einem Prolog wichtige Informationen zu dem beginnenden Stück gegeben. Darauf folgte das Einzugslied des Chors, der Parodos.

Sobald der Chor auf der Bühne positioniert war, sang er sein erstes Stasimon (Standlied), während dem der oder die Schauspieler auftraten, die an der nächsten Szene beteiligt waren. Die Geschichte der Tragödie wurde in den Epeisodia erzählt. Über den ganzen weiteren Verlauf der Aufführung wechselten Stasima und Epeisodia ab. Abgeschlossen wurde jede Tragödie mit einem Schluss- und Auszugslied des Chors, dem Exodus.
Aristoteles beschreibt als wichtigstes Merkmal der Tragödie die geschlossene Handlung. Diese ist nicht rein dadurch gegeben, dass die Geschichte einer einzelnen Hauptfigur erzählt wird. Die Aufgabe des Dichters sei es, alles Wichtige zu erzählen und dabei alles Unwichtige wegzulassen.
Als Regel für eine geschlossene Handlung ergibt das Prinzip der drei Einheiten:
- Einheit des Ortes: Das ganze Stück spielt an einem Ort, damit das Publikum nicht durch Umbauten im Bühnenbild gestört wird. (Aristoteles formulierte dieses Prinzip noch nicht selbst aus; das geschah erst in der Renaissance. Trotzdem wird sein Ursprung oft Aristoteles und seiner Poetik zugeschrieben)
- Einheit der Zeit: Die Handlung soll innerhalb von 24 Stunden ablaufen.
- Einheit der Handlung: Die Handlung soll folgerichtig und stringent sein. Es soll keine Nebenhandlungen geben, die für die eigentliche Geschichte nicht relevant sind.
Die Tragödie sollte so aufgebaut sein, dass erst die Vorgeschichte erzählt wird, sich dann die Handlung steigert, bis sie an ihrem Höhepunkt angelangt ist. An diesem Punkt schlägt sie ins Gegenteil um und fällt ab, bis es schließlich zu einer Lösung, einer Erkenntnis kommt.
Ein beispielhaftes griechisches Drama: Die Antigone des Sophokles
Die Geschichte der Antigone entstammt dem thebanischen Sagenzyklus und spielt in der Zeit nach dem Krieg um Theben, einer der wichtigsten Städte im Griechenland der Antike. Eteokles und Polyneikes, die Brüder von Antigone, hatten um die Herrschaft gekämpft und sind beide gefallen; Eteokles als Verteidiger der Stadt, Polyneikes als Verräter. Sophokles hat sie wahrscheinlich im Jahr 442 v. Chr. in Athen uraufführen lassen.
Das staatliche Recht sieht vor, dass der Feind nicht bestattet wird; darauf beruft sich auch Kreon, der neue König Thebens, und verbietet eine Bestattung Polyneikes. Dessen Schwester Antigone beruft sich hingegen auf die göttlichen Gesetze, die verlangen, dass jeder Tote bestattet wird.
Nachdem Antigone wegen der Bestattung ihres Bruders festgenommen wurde und gesteinigt werden soll, entbrennt ein Streit zwischen Kreon und seinem Sohn Haimon, der gleichzeitig der Verlobte Antigones ist und in der Rechtsfrage auf ihrer Seite steht.

Kreon ist erst bereit, seine Meinung zu überdenken, als ihm der Seher Teiresias den Tod seines Sohnes hervorsagt; eine Strafe der Götter für die Missachtung ihrer Gesetze. Der Sinneswandel Kreons kommt jedoch zu spät. Antigone hat sich bereits aus Angst vor dem Hungertod in ihrer Zelle erhängt und auch Haimon hat sich aus Schmerz darüber das Leben genommen.
Als schließlich noch die Ehefrau Kreons den Freitod wählt, weil sie den Tod ihres Sohnes nicht verkraftet, kommt Kreon zu der Erkenntnis, dass sein Handeln hochmütig und selbstherrlich war und er sich nun der gerechten Strafe durch die Götter fügen muss.
Die Antigone des Sophokles erfüllt die aristotelischen Prinzipien der Tragödie: die Handlung ist stringent und löst sich am Ende durch eine Erkenntnis auf. Das ganze Stück spielt sich an einem einzigen Tag vor dem Königspalast ab (Einheit von Zeit und Ort).
In einem Prolog wird die Ausgangssituation erklärt und beim Einzug des Chores wird die Vorgeschichte noch einmal aufgerollt. Anschließend folgen fünf Szenen, auf die jeweils ein Stasimon folgt.
Im Schlusslied singen der Chorführer, ein Bote und Kreon im Wechsel. Der Bote berichtet über die Selbstmorde, der Chorführer erklärt, dass Kreon selbst an dem Unglück schuld sein und Kreon stimmt dem zu.
In der Tragödie Antigone prallen zwei gegensätzliche und unvereinbare Weltbilder aufeinander. Ein glücklicher Ausgang wäre nur möglich, wenn Antigone und Kreon bereit wären, sich entgegenzukommen und ihre totalitäre Position aufzugeben. Damit würden sie sich aber, in ihren eigenen Augen, den Göttern beziehungsweise dem Staat gegenüber schuldig machen. So werden sie schuldlos schuldig.
Beginnt dir der Kopf zu rauchen und Deutsch ist einfach nicht deine Stärke? Es gibt in deiner Region, falls du in München lebst zum Beispiel auf Nachhilfe Deutsch München, super Nachhilfelehrer!
















Gerne hätte ich so die übrigen Tragödien und natürlich auch die Komödien erklärt. Gibt es dazu eine anschauliche Übersichtsliteratur?
Hat mir sehr gefallen!