Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr – Kritik
Alain Resnais’ dritter Spielfilm ist wieder das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit einem Schriftsteller: nach Marguerite Duras und Alain Robbe-Grillet nun Jean Cayrol.

Muriel oder die Zeit der Wiederkehr (Muriel ou le Temps d’un retour, 1963) spielt im November 1962 in Boulogne-sur-Mer an der französischen Atlantikküste. Die verwitwete Hélène Aughain (Delphine Seyrig) betreibt in ihrer Wohnung ein Möbelantiquariat. Sie lebt dort mit ihrem Stiefsohn Bernard (Jean-Baptiste Thierrée), der seit seiner Rückkehr aus dem Algerienkrieg von der Erinnerung an eine gewisse Muriel besessen ist. Hélène beschließt, ihre verlorene Jugendliebe (Jean-Pierre Kérien) zum ersten Mal nach zwanzig Jahren wiederzusehen. Alphonse reist mit der jungen Françoise (Nita Klein) an, die er als seine Nichte vorstellt, und quartiert sich mit ihr zusammen in Hélènes Wohnung ein.
Nach Letztes Jahr in Marienbad (L’année dernière à Marienbad, 1961), der Realitätsprinzip und Raum-Zeit-Strukturen vollkommen aufzulösen scheint, wirkt Muriel auf den ersten Blick fast wie eine konventionelle Erzählung. Die Handlung spielt an einem konkreten und identifizierbaren Ort und unterliegt einer offensichtlichen Chronologie, die Protagonisten sind mit einer Biografie und mit einer nachvollziehbaren Psychologie ausgestattet. Sie alle sind Opfer eines Traumas. Hélène hat die Trauer über ihre verlorene Jugendliebe nie wirklich verwunden. Bernard bringt aus dem Algerienkrieg das Trauma eines Täters wider Willen mit. Und schließlich schwebt über der Handlung das kollektive Trauma des Zweiten Weltkriegs. Da sind die Kriegsgeschichten, die sich die Figuren über verschollene Bekannte erzählen. Und da sind die Bilder von Boulogne-sur-Mer: Einschussstellen auf Straßenschildern und halb zugewachsene Häuserruinen neben frisch hochgezogenen Neubauten, Narben und schlecht verheilende Wunden einer Stadt ohne Vergangenheit. Der Fischerort hatte gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ganze Stadtteile in den deutschen und alliierten Bombardements verloren.

Hélènes Wohnung ist vollgestopft mit antiken Möbeln, die zum Kauf angeboten werden. Die Wohnung ist ständig im Wandel und wirkt wie eine räumliche Metapher für das menschliche Gedächtnis, wo der Traumatisierte nicht mehr weiß, wie sein Hirn geordnet ist. Es gehen Dinge verloren (Verdrängung) und tauchen unvermutet wieder auf (Intrusionen). Die Möbel kommen und gehen, wie auch die Figuren ständig in Bewegung sind, mit unwichtigen Dingen beschäftigt, wie auf der Flucht vor sich selbst und vor der eigenen Vergangenheit. Nicht einmal bis zum Ende einer Mahlzeit können sie am Tisch sitzen bleiben. Und obwohl fast ständig gesprochen wird, ist es den Figuren unmöglich, miteinander zu kommunizieren, weder Hélène mit Alphonse über ihre gemeinsame Liebe, noch Bernard über seine Erlebnisse in Algerien: „Muriel kann nicht erzählt werden.“ Einzig die Schauspielerin Françoise bleibt hellsichtig.

Zwar ist Muriel als lineare Erzählung in fünf Akten organisiert, jedoch sind diese im Film kaum zu erkennen. Denn die Struktur bricht sich im Laufe der Geschichte immer mehr. Der erste und letzte Akt spielen jeweils an einem Tag, die drei Akte dazwischen dehnen sich über zwei Wochen, die man als Zuschauer jedoch nicht recht wahrnimmt, so sehr wird die Handlung durch eine Vielzahl von Ellipsen und plötzlich aufblitzenden kurzen Bildern zerhackt. Resnais spielt damit, Einstellungen unterschiedlicher Länge im Schnitt nebeneinander zu setzen. Oft wurde das Montage-Mosaik des Films mit der kubistischen Malerei verglichen. Analog zur räumlichen Metapher der Wohnung reflektiert die zerstückelte Montage auf der Zeitebene kongenial die Psyche der Figuren.
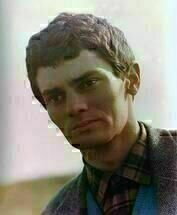
Aus heutiger Sicht wirkt Muriel, nicht zuletzt wegen der von Hans Werner Henze komponierten ätherischen Musik, recht befremdlich. Resnais’ Film entstand zu einer Zeit, in der der Strukturalismus die Psychoanalyse um Jacques Lacan wesentlich beeinflusste und die Traumaforschung nach den Kriegserfahrungen des 20. Jahrhunderts richtig in Schwung kam. Die Wunden des Zweiten Weltkriegs waren noch nicht verheilt, und Frankreich führte in seiner damaligen Kolonie Algerien einen erbitterten Kampf gegen die Unabhängigkeitsbewegung. Der Algerienkrieg, der zum Scheitern der IV. Republik führen sollte, war ein gesellschaftliches Tabu. Und auch Alain Resnais, der bereits mehrfach Opfer der französischen Zensur gewesen war, meidet eine direkte Auseinandersetzung mit dem heiklen Thema und erzählt in Muriel eine nur vermeintlich banale Geschichte. Noch bevor sich die Psychotraumatologie in den 1970er Jahren endgültig durchsetzte, hat Resnais mit Muriel für das Trauma eine ureigene filmische Form gefunden.
Trailer zu „Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr“

Trailer ansehen (1)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Neue Kritiken

Typhoon Club

The Other Way Around

Three Kilometres to the End of the World

Megalopolis
Kommentare
Es gibt bisher noch keine Kommentare.















