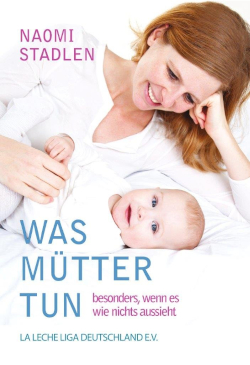Michelle Obama
Becoming – Meine Geschichte
Goldmann Verlag, München
ISBN: 978-3442314874
544 Seiten
26,- Euro
First Mom – Die Familie als Kraftquelle
Michelle Obama ist ein Familien-Freak – wohl auch deshalb, weil sie in zwar einfachen, aber behüteten Verhältnissen ganz ohne Krippe und Kita aufwuchs. Das bezeugt ihre Autobiographie „Becoming“, zu Deutsch: „Meine Geschichte“. Es ist das Lieblingsbuch des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika: Barack Obama. Er lässt keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, wie sehr ihm das Buch seiner Ehefrau Michelle gefällt. Wer die flott geschriebenen 542 Seiten der deutschen Ausgabe hinter sich hat, wird ihm zustimmen und gewinnt auf jeden Fall die Einsicht, dass ihre Familie für die ehemalige First Lady einen herausragenden Stellenwert besitzt. Der Begriff „First Mom“ wäre daher mindestens ebenso verdient.
Behütet
Michelle Obama beschreibt ihr Becoming von Kindheit an: gestartet in einfachen Verhältnissen in der South Side von Chicago, einem einst weißen, später überwiegend von Schwarzen bewohnten Viertel, stets gut behütet durch Eltern, die all ihre Kraft und Liebe – so vermittelt sie sehr glaubhaft und anschaulich – der Tochter und ihrem knapp zwei Jahre älteren Bruder schenken.
„Alles, was wichtig war, lag in einem Radius von fünf Blocks – meine Großeltern, meine Cousins und Cousinen, die Kirche an der Ecke, (…), die Tankstelle, zu der mich meine Mutter manchmal schickte, um eine Schachtel Newport zu holen, und der Spirituosenladen, in dem es (…) Milch in Gallonenflaschen gab.“
Aufwachsen in einer Intakten Familie in einer vertrauten Umwelt
Neben der als behaglich empfunden Umgebung eines einfachen Mittelstandsviertels erfährt der Leser eindrücklich vom Glück, in einer einfachen, aber intakten Familie aufgewachsen zu sein. Von wegen „frühkindliche Bildung“ in Krippe und Kita! Erst mit fünf – aus heutiger Sicht also unglaublich spät – kam sie in eine Vorschulklasse. Da sei die kleine Michelle „in zweifacher Hinsicht im Vorteil gewesen: Zum einen konnte ich bereits einfache Wörter lesen, zum anderen hatte ich über mir, in der zweiten Klasse, einen allseits beliebten Bruder. (…) Zu Fuß war man in zwei Minuten dort. Wenn man rannte, (…) dann in einer.“
Zur intakten Familie gesellte sich also ein äußerst geregeltes und aufgeräumtes Umfeld. Michelle entpuppte sich darin als äußerst ehrgeizig. Wo es etwas zu lernen gab, wollte sie vorn dabei sein. Deshalb gefiel ihr die Schule tendenziell auch sehr gut. Allerdings benennt die erwachsene Michelle auch unverblümt die Schattenseite jener Einrichtung, die ihrem ausgeprägten Bedürfnis nach Individualität, schon als kleines Mädchen, widerstrebte:
„Ich schloss mich nur selten den Kindern aus dem Viertel an, die nach der Schule draußen spielten, und ich lud auch keine Schulfreundinnen nach Hause ein, unter anderem, weil ich sehr pingelig war und nicht wollte, dass sich jemand an meinen Puppen zu schaffen machte. Bei anderen Mädchen zuhause hatte ich Horrorszenarien gesehen: Barbies mit gewaltsam verstümmelten Frisuren oder Filzstift-Tattoos im Gesicht. Und an der Schule lernte ich außerdem auch, dass Kinder sehr hässlich zueinander sein können. So nette Szenen man auch auf einem Pausenhof beobachten mag, dahinter verbirgt sich doch oft eine Willkürherrschaft aus wechselnden Hierarchien und Allianzen. Es gab Bienenköniginnen, Tyrannen und ihre jeweilige Gefolgschaft. Ich war zwar nicht schüchtern, aber außerhalb der Schule wollte ich eine solche Unordnung in meinem Leben nicht zulassen. Lieber verwendete ich meine Energie darauf, die einzige treibende Kraft in meinem kleinen Universum unseres Spielbereichs zu sein“.
Die Familie als Kraft-Quelle
Solch ehrliche Auslassungen über die Kehrseiten von Schule liest man selten, schon gar nicht von offizieller Seite. Und ebenso verpönt ist es heute, von Müttern zu schwärmen, die nicht berufstätig sind und deshalb ihren Kindern die volle Aufmerksamkeit schenken können. Genau das hat Michelle Obama aber erfahren und davon hat sie profitiert. Sie beschreibt dies an mehreren Stellen im Buch, die eindrücklichste startet in Kapitel 4, wo sie berichtet, wie sie regelmäßig gemeinsam mit ihren Freundinnen in der einstündigen Mittagspause von der Schule flüchtete und sich alle Mädels – die Wohnung lag ja in der Nähe der Schule – daheim von Michelles Mutter mit Sandwiches versorgen ließen.
„Das sollte mir zu einer Gewohnheit werden, aus der ich mein Leben lang Kraft schöpfte: mich mit einem quirligen Kreis enger Freundinnen zu umgeben und in einem sicheren Hafen weiblicher Weisheit festzumachen. In der Mittagsgruppe gingen wir durch, was am Vormittag in der Schule passiert war (…) Meine Mutter versorgte uns unterdessen gerne mit Essen. Sie bekam dadurch ganz zwanglos Zugang zu unserer Welt. Während meine Freundinnen und ich aßen und schwatzten, stand sie oft schweigend daneben, vertieft in irgendeine Hausarbeit und ohne zu verbergen, dass sie jedes Wort mit anhörte. Meine Familie lebte zu viert auf weniger als 85 Quadratmetern, so dass es bei uns sowieso nie so etwas wie Privatsphäre gab.“
Engagierte „Nur-Hausfrau“ und wichtigste Förderin – die Mutter
Wer nun meint, Michelles Mutter – die „Nur-Hausfrau“ – sei eine inaktive, langweilige Person gewesen, der wird schnell eines Besseren belehrt:
Sie war eine aufrechte Realistin und bewegte im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr viel. An der Bryn Mawr wurde sie deshalb schnell eines der aktivsten Mitglieder des Elternbeirats. Sie sammelte Geld, um die Klassenzimmer neu auszustatten, veranstaltete Festessen zum Dank an die Lehrer und setzte sich für die Einrichtung eines besonderen Unterrichtsraums für leistungsstärkere Schüler aus unterschiedlichen Klassenstufen ein. (…) letztlich also die begabteren Kinder zusammenzubringen, dass sie schneller lernen konnten.
Dass hiervon auch Michelle profitierte, ist wenig überraschend:
„Diese Idee wurde kontrovers diskutiert und als undemokratisch kritisiert, was ja jede Art von Begabtenförderung letztlich ist. Aber die Bewegung gewann landauf, landab an Fahrt, und während meiner letzten drei Jahre auf der Bryn Mawr Elementary School war ich eine der Begünstigten. Ich gehörte zu einer Gruppe von Schülern aus unterschiedlichen Klassenstufen. Wir saßen abseits vom Rest der Schule in einem eigenen Klassenzimmer und hatten eigene Zeiten für die Pause, das Mittagessen, Musikunterricht und Sport. Wir bekamen mehr geboten, zum Beispiel wöchentliche Fahrten zu einem Community College, wo wir einen Schreibkurs für Fortgeschrittene besuchten oder im Biologielabor eine Ratte sezieren durften. In unserem Klassenzimmer arbeiteten wir oft eigenständig, setzten uns selbst Ziele und lernten mit der Geschwindigkeit, die uns angemessen schien.“
Diese spezielle Förderung hatte Michelle also ihrer Mutter zu verdanken, die sich als einfache Hausfrau an der Schule offenbar enorm engagiert und sich später im Weißen Haus übrigens auch wieder rührend um die Enkeltöchter gesorgt hatte, wenn das Präsidentenpaar unterwegs war.
Geliebt aber nicht verhätschelt
„Ich erzählte meiner Mutter alles, was in der Schule so passierte. (…) Ich weiß nicht, wie sie es fand und wie sie sich dabei fühlte, eine klassische Hausfrau zu sein, statt einer bezahlten Arbeit nachzugehen. Ich wusste nur, wenn ich zu Hause auftauchte, war Essen im Kühlschrank, nicht nur für mich, sondern auch für meine Freundinnen. Ich wusste, dass wenn wir einen Klassenausflug machten, meine Mutter sich fast immer als Begleitung anbot. Sie zog sich ein hübsches Kleid an und legte dunklen Lippenstift auf, um mit uns ins Community College oder in den Zoo zu fahren. (…) Sie hatte nie viel Geld, war aber sehr einfallsreich. (…) Sie legte dabei die ganze Zeit über eine mütterliche Haltung an den Tag, die mir heute im Rückblick ebenso großartig wie unnachahmlich erscheint – eine Art unerschütterliche Zen-Neutralität. Ich hatte Freundinnen, deren Mütter mit ihnen ihre Höhen und Tiefen durchmachten, als wären es ihre eigenen, und ich kannte eine Menge anderer Kinder, deren Eltern zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren, um überhaupt für sie da zu sein. Meine Mutter war schlichtweg ausgewogen. (…) Ihre Liebe zu Craig und mir war unerschütterlich, aber wir waren nicht verhätschelt.“
Später, als Michelle älter und schon auf der Highschool war, fing ihre Mutter dann doch wieder an zu arbeiten – auch weil teures Schulgeld für die beiden Kinder bezahlt werden musste. Fest steht jedenfalls: Michelle Obama hat eine glückliche, behütete Kindheit genossen mit einer wunderbar einfühlsamen, kreativen, engagierten Mutter und einem pflichtbewussten, liebevollen Vater, der sich seine schwere Krankheit lange nicht anmerken ließ.
Familie und Karriere
Es verwundert daher nicht, dass Michelle später das Dasein als „First Mom“ im Weißen Haus vor allem deshalb genoss, wie sie schreibt, weil sie dort mit ihrer Familie endlich wieder beisammen war. Die Jahre zuvor waren nämlich sehr wechselhaft gewesen, weil der aufstrebende, zum Teil mehrere Ämter an verschiedenen Orten gleichzeitig ausführende Ehemann selten zuhause war. Aber Michelle ließ auch in Krisenzeiten nicht locker und überredete Barack sogar einmal zur Paartherapie: ein Scheitern der Ehe und Zerbrechen der Familie wäre für sie, die selbst ja in so glücklichen Verhältnissen aufwachsen durfte, sicher nicht in Frage gekommen.

Über die Buchautorin: Michelle Robinson Obama
war von 2009 bis 2017 die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie studierte an der Princeton University und an der Harvard Law School und begann ihre berufliche Laufbahn als Anwältin bei der Kanzlei Sidley & Austin in Chicago, wo sie ihren zukünftigen Ehemann Barack Obama kennenlernte. Später arbeitete sie im Büro des Bürgermeisters von Chicago, an der University of Chicago und am University of Chicago Medical Center. Michelle Obama gründete auch die Chicagoer Sektion von »Public Allies«, einer Organisation, die junge Menschen auf eine Laufbahn im öffentlichen Dienst vorbereitet. Die Obamas leben derzeit in Washington, D.C. Sie haben zwei Töchter, Malia und Sash