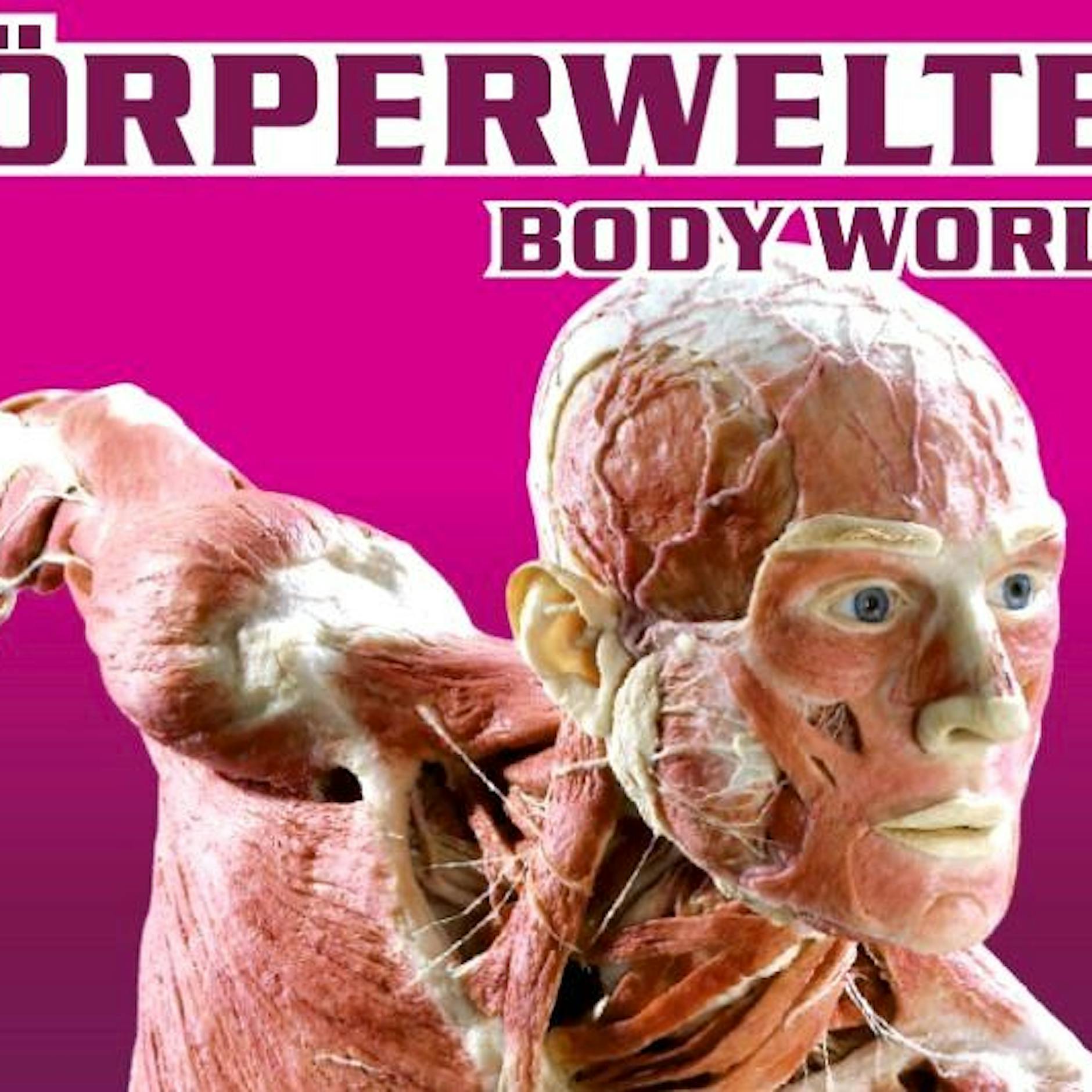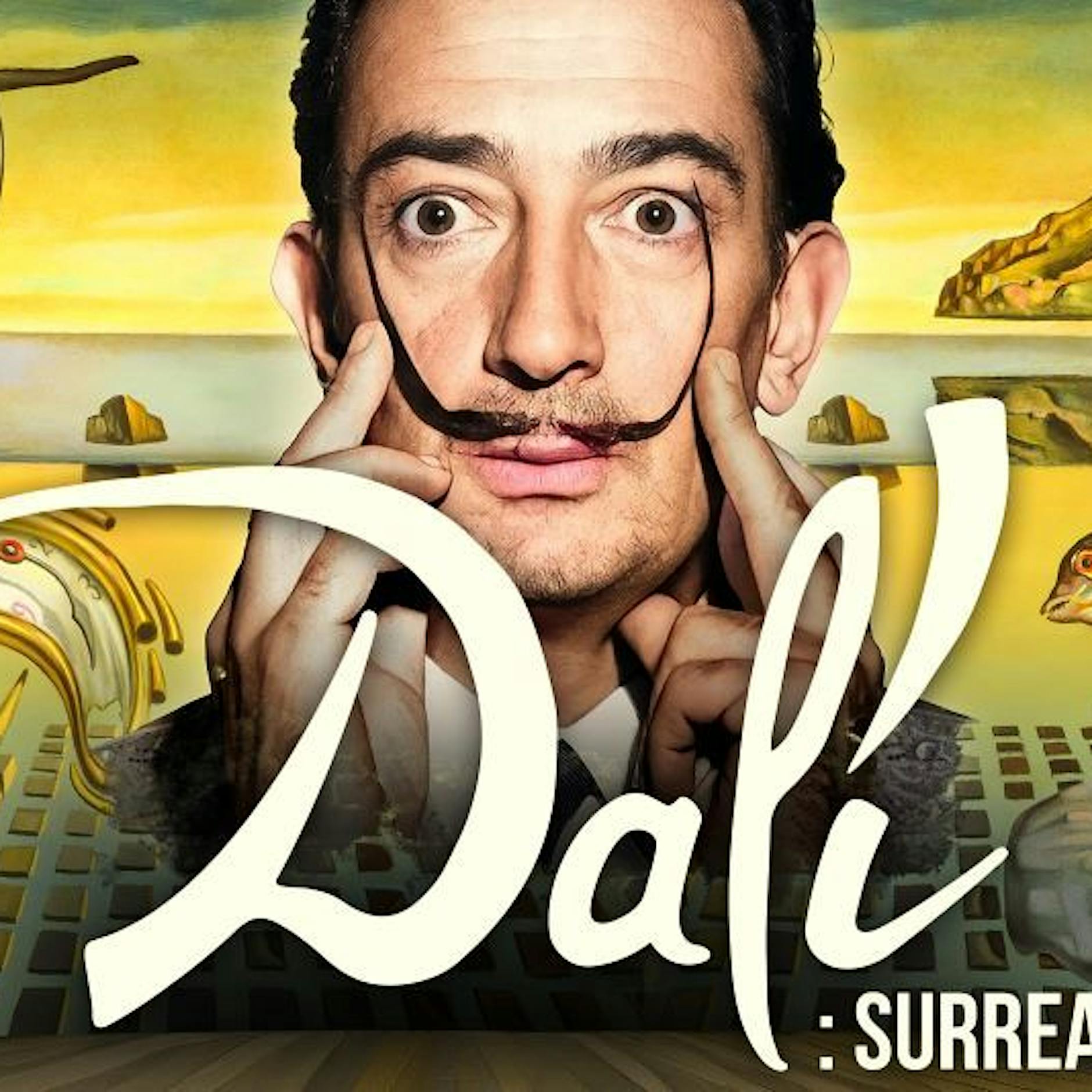In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 6./7. April ist die erste Kolumne von Katja Hoyer mit der Überschrift versehen: Eine offene Debatte ist nötig – nicht nur über die DDR. Ihr Bestseller „Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR“ hatte so widersprüchliche Resonanz erfahren, dass sie sich dringend einen anderen Umgang bei Streitthemen wünscht.
Das wäre mehr als nur wünschenswert, denn seit dem Anschluss der DDR hat es eine offene Debatte bisher nicht, zumindest nicht unter Beteiligung von einst in der DDR bekannten Wissenschaftlern gegeben.
Die Urteile über den untergegangenen Staat standen rasch fest: Die zweite deutsche Diktatur, ein Unrechtsstaat. Die umfängliche Arbeit der 1992 vom 12. Deutschen Bundestag beschlossenen Enquete-Kommission legte schon mit der Überschrift am Anfang fest, was herauskommen sollte: „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur“. Den umfänglichen Ergebnisses ihrer mehrjährigen Arbeit folgte inzwischen eine ähnlich unübersehbaren Fülle an Büchern von fast ausschließlich alt-bundesdeutschen Historikern – nach soliden Schätzungen deutlich über 7000 – sowie zahlreiche Erinnerungen und Zeitzeugenberichte meist von Menschen, die wann, wie und warum auch immer, in Konflikt mit der DDR-Obrigkeit gerieten und zum Teil schmerzlichen Repressionen und Benachteiligungen ausgesetzt waren.
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Wer sich mit differenzierten oder gar teils positiven Urteilen in diese Forschungsarbeit einmischte, fand sich rasch an der Seite oder als Verteidiger der schlimmen „Täter mit gutem Gewissen“ wieder. Das waren keine guten Bedingungen für einen Dialog, da scheinen Erinnerungen an einstige deutsch-deutsche Historikertreffen in West und Ost in den 80er-Jahren wie von einem anderen Stern.
Nun gibt es deutliche Unterschiede zwischen offener und öffentlicher Debatte. Katja Hoyer meint, sie hätte ihr Buch in Deutschland wohl gar nicht schreiben können. Nun schreiben wohl, aber ob sich ein renommierter Verlag gefunden hätte, ist tatsächlich fraglich. Der Erfolg des Buches in England hat ihr wahrscheinlich diese Tür bei einem deutschen Verlag geöffnet. Nicht nur meine persönlichen Erfahrungen besagen, dass vom Mainstream abweichende Publikationen bisher kaum eine Chance hatten.
Meistgelesene Artikel

Dabei gab und noch gibt es einige wenige aktive Spezialisten für DDR-Geschichte aus dem Osten, die mit einem nicht ganz kleinen Publikum seit 1990 eine sehr selbstkritische offene Debatte geführt haben, die sich auch in ein paar Dutzend Veröffentlichungen wiederfindet, die – von kleinsten Verlagen mit Druckkostenzuschüssen der Verfasser publiziert – als faktisch „graue Literatur“ vorliegen. Von der scientific society ignoriert blieben sie in der Öffentlichkeit fast völlig unbekannt. So verwundert es nicht, dass selbst in den Büchern von Dirk Oschmann und Katja Hoyer im Literaturverzeichnis kein einziger Titel von (international durchaus anerkannten) DDR-Spezialisten wie z.B. Siegfried Prokop, Günter Benser, Rolf Badstübner, Manfred Kossok, Kurt Pätzold, Harald Neubert, Walter Friedrich, Monika Kaiser, Mario Keßler, Detlef Nakath, Jörg Roesler, Alfred Kosing u.a. erscheint.
DDR-Spezialisten: Ignoriert und totgeschwiegen
Ich habe diese Erfahrung mit Ignoranz dagegen schon vor 30 Jahren gemacht, als mein Buch „Meinungsforschung in der DDR“ 1993 im Kölner Bund-Verlag in beachtlicher Auflagenhöhe erschien. Obwohl beim Verlag rund 100 Rezensionsexemplare angefordert wurden, gab es zu meiner Überraschung keine einzige Besprechung in einer Fachzeitschrift mit direktem Bezug auf das Buch, weder eine Polemik noch theoretische Kritik an den Methoden erfolgte. Das mir vom Verlag seinerzeit signalisierte große Interesse der Medien, darunter dritte Regionalsender wie der NDR, der Hessische Rundfunk und einflussreiche Magazine wie das Deutschland Archiv und der Spiegel, erlosch sehr rasch.

Ein ausbleibender Verriss kann auch ein Qualitätsmerkmal bedeuten. Nur in den USA wurde es von Anne Constabile-Heming, Professorin an der Pennsylvania State University sachlich und informativ vorgestellt und gewürdigt, „dass sich die Mehrheit der DDR-Bürger mit dem sozialistischen System und dem Status quo abgefunden hat“. Hier im Lande war mein Buch durch Ignoranz und Totschweigen Opfer einer Art von Zensur geworden. Was war geschehen?
Ich erfuhr vertraulich, dass bei der Verlagsleitung Briefe von Professoren eingegangen waren, die heftig dagegen protestierten, dieses Buch weiter zu bewerben und zu verkaufen. Mit Bedauern und höflich verklausuliert, teilte mir die Redakteurin mit, es habe gegen gewisse Wertungen Einspruch gegeben. Ich ahnte, worum es sich handeln dürfte, hatte ich mich doch am Schluss des Unterkapitels „Die DDR am Ende der Ulbricht-Ära im Spiegel der Meinungsforschung“ erdreistet festzustellen:
„Wie auch immer die rein rechnerische Bilanz der Ulbricht-Ära in den Statistiken der Fachleute ausfallen mag, die Ergebnisse der Meinungsforschung bestätigen, dass die Entwicklung in den 60er-Jahren bei einer Mehrheit der DDR-Bevölkerung zu einer mentalen Akzeptanz des Systems und des deutsch-deutschen Status quo geführt hatte. Die DDR war nicht mehr nur von einer aktiven Minderheit ‚angenommen‘, die SED erfüllte das Minimalkriterium jeglicher Legitimität: Die Mehrheit des Volkes anerkannte die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen die SED den politischen (und ideologischen) Anspruch auf das Recht zur Führung von Staat und Gesellschaft erhob (…). Die bestehende Ordnung wurde in diesem Zeitraum zumindest – um mit Habermas zu sprechen – alles in allem für ‚anerkennungswürdig‘ befunden, da sie perspektivisch die Verwirklichung ihrer konstitutiven Ideen versprach.“

Das beruhte auf validen Daten aus im Buch dokumentierten Umfrageberichten. Der Verlag sah sich jedoch veranlasst, Werbung und Verkauf des Buches einzustellen. Man teilte mir mit, der Rest werde „geschreddert“, ich könnte aber zum halben Preis von 15,- DM noch Exemplare ordern. Nicht nur die SED hielt also die Ergebnisse solider Meinungsforschung geheim, das gelang auch anderen.
Die Frage nach der historisch-politischen Legitimität der DDR
Den Vogel schießen zwei Spezialisten für Umfrageforschung noch fast 25 Jahre später ab: Everhard Holtmann, jahrelang Sprecher des DFG-Sonderforschungbereichs „Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systembruch“ der Universitäten Jena und Halle und emeritierter Professor und Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle, sowie die Kommunikations- und Politikforscherin Dr. Anne Köhler, die als geschäftsführende Gesellschafterin das DDR-Forschungsprojekt zur Umfrageforschung bei der Bevölkerung der DDR zwischen 1968 und 1989 leitete. Beide gehen – kaum glaubhaft aus Unkenntnis – an meinem ersten genannten Buch aus dem Jahr 1993 und auch meinem zweiten Buch zur Politischen Kultur und Meinungsforschung in der DDR von 1995 vorbei. Ausdrücklich bedauern sie: „Exakte Daten (…) liegen nicht vor. Solche Daten sind nicht etwa, wie zahlreiche Aktenbestände der Staatssicherheit, in der Endzeit der DDR gezielt vernichtet worden. Sie wurden vielmehr im Land selbst zu keiner Zeit erhoben.“

Es wird sicherlich auch in weiterer Zukunft noch Differenzen und Streit um die Beurteilung verschiedener Tatbestände und Prozesse zwischen den Fachleuten und politischen Kombattanten, wie im öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs der nachfolgenden Generation geben. Wenn der Streit tolerant und auf Augenhöhe erfolgen soll, müssten schon die differenzierenden Forschungsergebnisse der mit „Gnadenlosigkeit ausgetauschten“ Historiker-Elite – so Oschmann – zur Kenntnis genommen werden. Es würde rasch klar werden, dass eine vorausgehende Festlegung auf die Charakterisierung der DDR als zweite Diktatur und Unrechtsstaat, wie ihn auch Oschmann „fraglos“ sieht, jeder Debatte Grenzen setzt. Und diese Grenze wird durch die jeweilige Antwort auf die Frage nach der historisch-politischen Legitimität der DDR als einer von zwei politisch-moralisch gerechtfertigten Alternativen nach Nazifaschismus und Weltkrieg markiert sein. Davon hängt auch ab, ob und wie die Geschichte der DDR als Teil der gesamtdeutschen Nationalgeschichte begriffen und akzeptiert werden kann.
Heinz Niemann, geboren 1936, ist Historiker und Politikwissenschaftler. Er lehrte als Professor in Leipzig und Berlin und hat mehrere Bücher veröffentlicht, speziell zur Parteiengeschichte der SPD, SAPD, SED, PDS-Linkspartei.
Das ist ein Beitrag, der im Rahmen unserer Open-Source-Initiative eingereicht wurde. Mit Open Source gibt der Berliner Verlag freien Autorinnen und Autoren sowie jedem Interessierten die Möglichkeit, Texte mit inhaltlicher Relevanz und professionellen Qualitätsstandards anzubieten. Ausgewählte Beiträge werden veröffentlicht und honoriert.
Empfehlungen aus dem BLZ-Ticketshop: