True Grit – Kritik
Der Western ist tot?

True Grit, das bislang kommerziell erfolgreichste Projekt der Coen-Brüder, wirft viele Fragen auf. Die oberflächlichste: Weshalb der Hype? Grundlegender: Wie steht es um das „amerikanische Kino par excellence“ mehr als 50 Jahre nach André Bazins Huldigung des Western? Außerdem: Warum spielt Jeff Bridges in einem Film über John Wayne? Und was macht Matt Damon an seiner Seite? Vor allem aber: Wozu dieser Film?
In dem Moment, wo sich ein Werk ins Genre einschreibt, ist es per se schon reflexiv. Dennoch fordert die Eingliederung in einen solchen Korpus den Filmen sukzessive immer mehr ab. Irgendwann genügt das Genre sich nicht mehr selbst, hat sich auserzählt, sich überlebt. Spätestens jetzt benötigt jeder Beitrag, der sich nicht grenzenlose Naivität vorwerfen lassen will, ein Surplus. Beispielhaft dafür ist fast die gesamte zweite Hälfte der Schaffensphase des Leinwand-Westernhelden schlechthin: John Wayne. Spätestens seit Der schwarze Falke (The Searchers, 1956) war jeder John-Wayne-Western ein Meta-Western – bis zu dessen allerletztem Film The Shootist (1976). Gerade diese beiden beschäftigten sich dezidiert mit der Persona ihres Stars. True Grit von 1969 (im deutschen Verleih Der Marshal), ein solider Western des mehr als soliden Regisseurs Henry Hathaway, ist vor allem in die Filmgeschichte eingegangen, weil er John Wayne eine relativ ungewöhnliche Rolle bescherte, für die dieser prompt mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.
Charles Portis’ Roman True Grit konfrontiert die selbstbewusst-burschikose Mattie mit dem scheinbar rücksichts- und gnadenlosen Deputy-Marshal Reuben Cogburn. Beide stehen sich in ihrer Dickköpfigkeit in nichts nach. Ansonsten ist das Verhältnis dichotomisch geprägt: Jung trifft auf Alt, Tugendhaftigkeit und Unschuld auf das Gegenteil. Während das Mädchen für die Zukunft des sich wandelnden Landes steht, verkörpert „Rooster“ dessen Vergangenheit.

Ungewöhnlich an Hathaways Western ist die Perspektive des Mädchens. Zwar thematisiert das Genre – am nachdrücklichsten in Mein großer Freund Shane (Shane, 1954) – gerne den Blick des Kindes auf die Gewalt des Westens, doch dass eine minderjährige Figur, zumal ein Mädchen, derart ins Zentrum des Geschehens gerückt wird, erstaunt nachhaltig. Im Film ist es Kim Darby, die den Widerpart Waynes gibt – und ihm so erstaunliche Reaktionen abgewinnt. Auch wenn True Grit in erster Linie ein Film über die Persona seines Stars ist, gelingt es Hathaway darüber hinaus, einen sehenswerten Genrebeitrag zu inszenieren. Die gesellschaftlichen Konflikte und zwischenmenschlichen Spannungen entladen sich vor der Naturkulisse Colorados, die in sattem Grün mit wuchtigen Erben von der Manfest Destiny, von God’s Own Country zeugt. Die amerikanischen Mythen schreiben sich ein in dieses Epos, das den Western als Familienfilm begreift. Hier geht die Gefahr schon lange nicht mehr von der Natur aus. Und obwohl die Protagonisten durchs „Indian Territory“ reiten, ist auch der Native American keine Bedrohung mehr. Was Mattie ergründet, ist die Natur des Menschen. Ihre Reise gestaltet sich von Anfang an als eine Konfrontation mit dem Tod. Dementsprechend endet sie auf einem Friedhof. Mattie ist in der Männerwelt außerhalb der Städte verschiedenen Modellen begegnet, die zwei verschiedene Formen der Liebe repräsentierten: väterliche Zuneigung und sexuelle Verheißung. Hathaways in Schneeweiß gehüllte, wunderbare Schlusssequenz ist der Höhepunkt des Originals. Sie hat zwei Enden parat: Eines schließt den Film auf Mattie. Dann folgt ein Freeze Frame, der die Legende Wayne als Denkmal zementiert.
Über 40 Jahre später ist es Paramount Pictures gelungen, das Remake auf Platz Eins der amerikanischen Kinocharts zu hieven – mit einem Einspielergebnis von über 150 Millionen Dollar. Der Western ist weltweit sowohl in Cineplexen als auch in Arthousekinos programmiert, er eröffnet die Berlinale und kann vor Oscarnominierungen kaum laufen.
Am Genre liegt es nicht. Der letzte ähnlich erfolgreiche Western, Der mit dem Wolf tanzt (Dances with Wolves, 1989) liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück. Danach gab es noch Clint Eastwoods Erbarmungslos (Unforgiven, 1992), den eigentlich rechtmäßig letzten Western. In den vergangenen Jahren kamen schließlich zwei amerikanische Western in die Kinos, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können: Zunächst Andrew Dominiks genialer Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford (The Assassination of Jasse James by the Coward Robert Ford, 2007), der gleichzeitig eine ästhetische Experimentalformel, eine Genrereflexion und eine Medienanalyse ist, dann Todeszug nach Yuma (3:10 to Yuma, 2007), der missglückte Versuch, die Leiche eines Westernklassikers zu fleddern und mit uninspirierter Action vermeintlich aufzupeppen.

Im Gegensatz zum künstlerischen Yuma-Desaster hat das Studio diesmal die richtige Strategie gefahren. Der vorhersehbare Triumph hängt zusammen mit den Regisseuren und ihren Hauptdarstellern. Jeff Bridges, Matt Damon und die Coen Brothers, das ist, gut vermarktet, momentan der Freifahrtschein zum Kinoerfolg. Seit No Country for Old Men (2007) sind die Brüder Everybody’s Darlings. Endlich mal Autorenkino, das jeder verstehen konnte. Technisch perfekt für die Ästheten, Formalisten und Handwerkliebhaber, skurril genug für die Arties, Genre für die Mitte, dessen Zersetzung für die Reflektierten, eine mythische Figur für den Rest. No Country for Old Men war so massenkompatibel, dass er bei der Sight & Sound den Durchschnittsplatz 1 in der Umfrage nach den besten Filmen der 2000er erreichte. Fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit haben die Coens den kleinen A Serious Man (2009) ein- und jetzt den großen, publikumswirksamen True Grit nachgeschoben. Besetzt mit Jeff Bridges auf dem Höhepunkt seines dritten Frühlings, dem jungen Multiplex-Publikum dank Tron Legacy (2010) in realiter und computergeneriert vertraut, außerdem quasi ohne Gegenstimme oscarprämiert für das Porträt eines Countrysängers: Da liegt der Westerner doch nahe. Und den Dialekt darf er gleich beibehalten.
Auch Matt Damon, hier in der Rolle des Trottels, die er alle Jahre wieder so gerne annimmt und die ihm so gar nicht steht, darf sich im Nuscheln üben. Bei den Golden Globes vergangene Woche hatte er Robert De Niro den Cecil B. DeMille Award überreicht, was jener mit der Vermutung, es werde nicht lange dauern, bis Damon hier seine eigene Trophäe entgegennähme, dankte. We doubt that.

Nächtliche Dunkelheit, künstliches Licht. Voice-over. Schon die Eingangssequenz macht deutlich, wie sich die Coens von Hathaway abgrenzen wollen. Setting, Natur, Bild – alles artifiziell, am Anfang und am Ende. Wenn Mattie (Hailee Steinfeld) in Ford Smith ankommt, sieht es aus, als habe sich ein Disney-Zeichner im Department verlaufen. Die wenigen Blicke, die der Zuschauer hier vom Umfeld erhascht, wirken wie eine ungesunde Mixtur aus lieblosen Bauten und Animation. Im Vordergrund ohnehin fast durchgängig: Mattie. Modebewusster als ihre ’69er-Vorgängerin. Wie das gesamte Cast. Die Farben sind dezent gehalten, die Palette beschränkt sich weitestgehend auf Braun- und Schwarztöne. Erstere sind dem Texas-Ranger LaBoeuf (Damon) zugeschrieben, Letztere dem Marshal (Bridges) und Mattie. Die beiden begegnen sich das erste Mal – auf dem Klo. Mattie außen, er innen. Coen-Humor. Derlei Skurrilitäten durchziehen den Film, der dennoch insgesamt straffer erzählt ist als das zu Abschweifungen neigende Original. Beiden gleich ist die lang geratene Exposition. Nach dem Aufbruch in Fort Smith trennt sich dann endgültig die Spreu vom Weizen. Das Original konfrontiert Mattie mit Männern aus einer Welt, die sie nicht mehr begreifen wird, fernab der Zivilisation. Und dennoch kommt sie ihnen auf gespenstische Art und Weise nahe, genauer noch: diese ihr. Ned Pepper, der Mattie auf die Spur des Mörders ihres Vaters bringen soll, sieht und erkennt etwas in ihr. Vermutlich versteht er sie besser als LeBoeuf. Pepper ist ein Mann in derselben Grauzone wie Cogburn. Die beiden Kontrahenten respektieren, ja schätzen sich. Sie wissen, dass ihre Zeit abgelaufen ist, arbeiten sich ab an der Zivilisation. Die Komplexität im Verhältnis von Pepper zu seinen Jägern ist vor allem dem Spiel Robert Duvalls zu verdanken. Hathaway konfrontiert nicht nur Mattie mit dem „Anderen“, er stellt auch Wayne einer jungen Generation an Method Actors gegenüber, zu denen unter anderem Dennis Hopper gehört. Aus diesem Verhältnis zieht die Literaturverfilmung einen nicht unerheblichen Teil ihrer Energie. Die Coen Brothers erlauben sich den Scherz, Pepper mit einem Namensvetter – Barry – zu besetzen und ihn nach allen Regeln der Kunst zu entstellen. Hinter der nach einem Zahnarzt schreienden Fratze verbirgt sich nichts. Die postmoderne Zeichnung des Antagonisten sieht keine Ausdifferenzierung vor.
Und selbst wenn Matt Damon eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Vorgänger Glen Campbell nicht abzusprechen ist, wird an der Differenz dieser Besetzung endgültig das Verhältnis der jeweiligen Filmemacher zum Genre deutlich. Campbell reiht sich ein in die jungen, namenlosen Grünschnäbel, die an der Seite Waynes reiten. Auch hier arbeitet Hathaway mit Konfrontationen, in dem Fall ist es Laienschauspiel, das auf die Routine des Duke trifft. Vor allem aber ist Campbell ein Country-Sänger und bringt somit eine Nähe zum Genre mit. Wichtiger als sein Part in der Handlung ist der Titelsong, den er beisteuert. Sein „True Grit“ nimmt ganz klassisch die Handlung vorweg, gibt den Ton vor. Die Coens verzichten nicht nur auf einen Titelsong, sie geben dem ganzen Score eine andere Note. Auch der ist düsterer und weiter weg vom Genre.
Seit ihrem Erstlingswerk haben sich die Brüder immer wieder auf die Filmgeschichte bezogen, sind in sie eingetaucht, haben sich an Genres abgearbeitet, sie relativiert, persifliert, dekonstruiert, reanimiert. Der immer gleich bleibende Gestus ist jener der Distanz. Die Coens blicken auf die Filmgeschichte und ihre Genres, sie spielen damit, kommentieren. Im Idealfall, wie bei Barton Fink (1990), ist das so innovativ, sind die Brüder so bei sich selbst, dass etwas genuin Eigenes entsteht, das überdauern kann. Im schlimmsten Fall, wie jetzt bei True Grit geschehen, löst sich der Stoff in seinen Bezügen beinahe auf, wird unkenntlich.
Und kommt somit vielleicht gerade mitten in Hollywood an. Dort, wo man die ehemaligen „Outsider“, heißen sie Coen, Aronofsky oder Fincher, gerne eingemeindet. Dort, wo sie nur darauf warten, ihre Ikonen, sind die erst einmal im richtigen Alter, mit dem Oscar auszuzeichnen. John Wayne ist es so ergangen, Jeff Bridges ebenso. Da auch die Coen Brothers bereits ausgezeichnet wurden, ist davon auszugehen, dass sie diesmal ehrenvoll im Finale ausscheiden. Ihrem Film ist das egal, er wird bis dahin schon ein sensationeller kommerzieller Erfolg sein. Für die Kinogeschichte gemacht ist er nicht. Denn dem Genre, dem er sich widmet, vermag er weder irgendwas abzugewinnen noch hinzuzufügen.
Der Western ist tot. Auch und erst recht nach True Grit.
Trailer zu „True Grit“

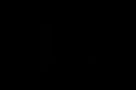
Trailer ansehen (2)
Bilder




zur Galerie (8 Bilder)
Neue Trailer
Neue Kritiken

Gasoline Rainbow

Furiosa: A Mad Max Saga

Anora

Typhoon Club
Kommentare
Howard Hawks
Werter Herr Keilholz!
Die letzten Filme der Coens - vor allem auch TRUE GRIT - waren konsequenter und stilsicherer als vieles, was ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Vielmehr: sie sind ein Grund, warum ich das KINO liebe. TRUE GRIT ist eine konsequente Weiterentwicklung ihres cinematografisch perfekten Stils, sowie ihrer genauen, beabsichtigt überzeichneten Charakterstudien; darauf gehen Sie in ihrer Kritik ein - und argumentieren zu unrecht herablassend über die Coens. Bei "Everybody's Darling" haben Sie sich für mich inhaltlich und formal disqualifiziert, ihr Stil wird überheblich. Ich habe selbst NO COUNTRY im Kino vorgeführt, habe ihn mehr als einmal gesehen, unter großem und kleinem Publikum. Die Leute waren verunsichert nach diesem Film, weil sie etwas publikumsfreundlicheres erwartet hatten. DAS war die interessante Oscar-Entwicklung dieses Films und die Coens haben diese Auszeichnung, entsprechend ihrer sarkastischen Weltsicht für ihr wahrscheinlich am meisten missverstandenes Werk erhalten. Wieso legen SIE Wert auf den Oscar und lassen das in Ihre Kritik einfließen?
Auf der einen Seite loben Sie den - mir sehr wohl bekannten - Stil von JESSE JAMES (2007) und kritisieren gleichzeitig einen ähnlich düsteren (in Bezug auf alles, was Sie richtig erwähnen, Score, Bildsprache...) Coen-(Meta-)Western. Bei JESSE JAMES sagten Sie den Lesern, Andrew Dominik hat uns den Western zurückgebracht. In ihrem schwachen, erzwungenen Ende dieser Kritik verheißen Sie den Western schon lange tot. Das verstehe ich nicht.
Und der Western hat sich eben noch nicht auserzählt, das beweisen Filme wie TRUE GRIT, SERAPHIN FALLS und JESSE JAMES von Dominik. Auch NO COUNTRY FOR OLD MEN war in gewisser Weise ein Western. Wieso vergleichen Sie nicht die formale Weiterführung des Coen-Stils seit diesem wichtigen Werk, anstatt es vordergründig zu verreißen? Und wieso stellen Sie das Original so in den Vordergrund? True Grit erzählt bewusst aus einer anderen Perspektive und IST AUCH DESWEGEN EIN EIGENSTÄNDIGES CINEMATOGRAFISCHES WERK, was kein Publikum überzeugen möchte, das wie Ethan Edwards alten Werten hinterherhinkt.
Auf dass die Coens uns noch lange mit wunderbaren Kinofilmen begeistern!
Filmfreek
Ich bin richtig gespannt auf True Grit, vor allem, nachdem ich Jeff Bridges erst vor Kurzem in Tron: Legacy gesehen habe. Es stimmt einfach, dass in der Regel männliche Schauspieler interessanter werden, je älter sie werden;-)
Danke für den Vorgeschmack auf True Grit!
csaba
sehr langweilig schlechter film! überbewärtet
sk
Lieber H.H.,
zunächst einmal freut es mich, dass Ihnen der Text trotz meiner inhaltlichen und formalen Disqualifikation einen Kommentar wert war. Auch wenn Sie anderer Meinung über den Film sind, sollten Sie meine Argumentation allerdings ernst nehmen. Den "cinematografisch perfekten Stil" bestätige ich ja sogar - genau heißt es in Bezug auf "No Country for Old Men": "Technisch perfekt für die Ästheten". Im Übrigen halte ich genannten Film - im Gegensatz zu den schwächeren "True Grit" und "Burn after Reading" - für durchaus gelungen. Mir ging es nur um das Phänomen der Massenkompatibilität - hier nenne ich unterschiedliche Faktoren: die Academy Awards (die mich als Indikator interessieren, nicht mehr und nicht weniger), die Kritikerabstimmung und das Erreichen einer bestimmten Zuschauerzahl, vor allem auch auf vermeintlich verschiedenen Märkten. "No Country" habe ich im völlig ausverkauften größten Saal des Cinestar Sony Center gesehen - das ist doch eher ungewöhnlich für die Coens. Bei "True Grit" nun ist es zumindest schon einmal in den USA ähnlich gelaufen und sicherlich werden auch Sie sich in Ihrem Kino über viele Zuschauer freuen.
Zum Ende meiner Kritik - und zu Ihrem besseren Verständnis: Alle 1-2 Jahre (Ihre Zählung) oder alle 15 (meine) ein ernsthafter Beitrag spricht noch lange nicht für die Lebendigkeit eines Genres, sondern eben für das Gegenteil. Und selbst, wenn ich Ihre Meinung die Qualität von "True Grit"betreffend nachvollziehen würde - das Verhältnis zum Genre - zu den Mythen, auf denen es basiert - stimmt eben doch nicht. Und natürlich kann man keinen Film machen und so tun, als gäbe es kein Original (in diesem Fall eine erste Literaturverfilmung). Hathaways Starvehikel - bei allen Schwierigkeiten - ist ein nicht unbeachtlicher Teil der Westerngeschichte. "True Grit" der Coens, so meine Argumentation, nicht.
Dass die Coens Sie noch lange begeistern wünsche Ich Ihnen natürlich. Den Cineasten unter Ihrem Publikum würde ich dann vielleicht doch - eine Affinität scheint ja vorhanden - lieber mal eine Vorstellung von "Rio Bravo" wünschen.
Peter
Es geht Ihnen um die Massenkompatibilität ? Das heisst, sie sehen sich als Kritiker, der Sie sind, als Teil der Elite. Darum ist allein schon der Umstand, dass ein Film zum Kassenschlager wird, disqualifizierend.
Wichtig ist die Abgrenzung: Ich gehör doch nicht zur Masse. Was mir gefällt, das gefällt nur wenigen, der intellektuellen Elite eben.
Das zumindest ist der Duktus ihrer Filmkritiken, so kommt das bei mir an.
sk
Lieber Peter,
vielen Dank der Nachfrage, vielleicht gelingt es mir, das Missverständnis aufzuklären. Mich interessiert nicht die Differenz Masse vs Nische. Um Elite geht es mir in diesem Fall auch nicht. Die Ausgangsfrage, die ich mir gestellt habe, lautet: wie kann es sein, dass ein Western, bzw ein Film, der sich einem toten Genre widmet, so erfogreich ist? Und welche Entwicklung haben die Coen-Brothers genommen? Man kann Massenkompatibilität ja auch positiv werten.
Grundsätzlich finde ich interessant, welche Tendenzen sich aus den großen Preisverleihungen ablesen lassen. In diesem Jahr sind ja lauter ehemalige "Außenseiter" wie Fincher, Aronofsky, die Coens, Boyle (für den besten Film, als Prod.) nominiert. Und es handelt sich jeweils um sehr konventionelle Filme im Vergleich zum Gesamtwerk der Regisseure. Tatsächlich halte ich Konventionalität gegenüber Individualität und Innovation für weniger berauschend. Tom Hoopers The Damned United ist als Film dem jetzt nominierten The Kings Speech auch deutlich vorzuziehen. Und - um auf das Ausgangsthema zurückzukommen: Der Erfolg von True Grit scheint darin zu liegen, dass sie sich gar nicht um das Genre kümmern. Was sie von der ersten Verfilmung gelernt haben: Der Stoff eignet sich als Starvehikel und als - massenkompatible - Familiengeschichte mit rührigem jungen Mädchen - auch immer wieder beliebt in der Hollyood- und Oscar-Community.
Antje und Maxim
True Shit
Dr. Andreas+Jacke
Western von Gestern?
True Grit - ist der erste Film der Cohen Brüder - der mir gefällt. Er ist überraschend angepasst und persifliert doch das Genre in ihrem typischen Stil. Es ist lange Zeit nach John Wayne noch amüsant - wenn 14 jährige Mädchen alten Saufbolden und Haudegen sagen wo es langt geht. Neues gibt es in dem Film tatsächlich nicht - aber manchmal ist unsere Fortschrittsglaube so blind... das wir gar nicht merken - das uns im Kino sowieso fast häufig dasselbe serviert wird...Der Schluss des Films ist beispielsweise einem Gedicht von Goethe nachempfunden...indem ein Vater mit seinem Kind auf einem Pferd durch die Nacht reitete... Des "Erlkönigs" erste Strophe im Western.... das ist schon toll. Gemerkt haben wird es kaum jemand. Vielleicht nicht einmal die Cohen-Brüder... Ein toller Film der sehr viel Spass macht!!!!
RekaRena
True Grit muss man nicht gesehen haben, der Hype ist mir unverständlich. Schaut Euch lieber "Rango" an, das ist ein beeindruckender Animationswestern!
juna
Durch Zufall bin ich auf Ihre Kritik gestoßen und ich muss zugeben, sie liest sich stellenweise nicht ganz einfach.
Für mich persönlich war es dennoch -oder auch gerade deswegen- ungeheuer wohltuend, diesen Text zu lesen, der für sich den Mut in Anspruch nimmt, gegen den vorgegebenen Strom zu schwimmen.
Als nicht studierter Cineast sind die Fähigkeiten zur ausführlichen Analyse bedauerlich nur in begrenztem Maße vorhanden- dennoch hatte auch ich nach dem Sehen ein deutlich enttäuschtes Gefühl. Dass ich nun einige meiner Hauptkritikpunkte gerade in ihrer Bewertung wiedergegeben finde, macht mich ungeheuer froh. Nicht, wegen der intellektuellen Aura, sondern eben einfach dem Umstand geschuldet, dass es hin und wieder tatsächlich eine gegenläufige Kritik in der Presse gibt. Selbst bei komerziell hochgelobten Kino-und Literaturproduktionen.
Werner
Ich verstehe nicht was es bei diesem Film zu motzen gibt. Tolle Bilder, klasse Schauspieler, herrlich witzige Dialoge. Ich fühlte mich bestens unterhalten .. wie von den Coen Brothers gewohnt. Chapeau!
Maddin
Ich habe das Original nicht gesehen, bin kein Westernanhänger und ergehe mich nicht in Metaebenen während ich mir einen Film ansehe, denn ich will ja in den Film rein.
Bei True Grit bleibe ich immer weit weg. Der Film will nichts richtig sein. Er ist nicht richtig lustig, reißt aber Witze - man muss dann hier und da mal grinsen. Er ist nicht richtig nachdenklich, wird aber pathetisch, was den Gerechtigkeitssinn des Mädchens angeht.
Schon gar nicht ist er spannend, will aber das Fürchten vor dem gemeinen Vatermörder lehren.
Schauspielerisch ist der Film Durchschnitt: Bridges zieht seinen Stiefel durch, den man nun wirklich schon zehn Mal gesehen hat. Damon ist einfach lächerlich und wirkt tierisch bemüht zum großen Persiflator zu mutieren und Hailee Steinfeld ist einfach nur gnadenlos unrealistisch frühreif.
Das Ding ist ziemlich überschätzt und hat mich schnell gelangweilt.
Hunter
Langweiligster film aller zeiten



















13 Kommentare