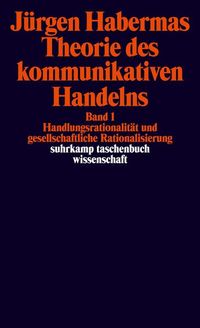
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Einleitung: Zugänge zur Rationalitätsproblematik
1. "Rationalität"-eine vorläufige Begriffsbestimmung
2. Einige Merkmale des mythischen und des modernen Weltverständnisses
3. Weltbezüge und Rationalitätsaspekte des Handelns in vier soziologischen Handlungsbegriffen
4. Die Problematik des Sinnverstehens in den Sozialwissenschaften
II. Webers Theorie der Rationalisierung
1. Okzidentaler Rationalismus
2. Die Entzauberung religiös-metaphysischer Weltbilder und Entstehung moderner Bewußtseinsstrukturen
3. Modernisierung als gesellschaftliche Rationalisierung: Die Rolle der protestantischen Ethik
4. Rationalisierung des Rechts und Gegenwartsdiagnose
III. Erste Zwischenbetrachtung: Soziales Handeln, Zwecktätigkeit und Kommunikation
IV. Von Lukács zu Adorno: Rationalisierung als Verdinglichung
1. Max Weber in der Tradition des westlichen Marxismus
2. Die Kritik der instrumentellen Vernunft
Band 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft
V. Der Paradigmawechsel bei Mead und Durkheim: Von der Zwecktätigkeit zum kommunikativen Handeln
1. Zur kommunikationstheoretischen Grundlegung der Sozialwissenschaften
2. Die Autorität des Heiligen und der normative Hintergrund kommunikativen Handelns
3. Die rationale Struktur der Versprachlichung des Sakralen
VI. Zweite Zwischenbetrachtung: System und Lebenswelt
1. Das Konzept der Lebenswelt und der hermeneutische Idealismus der verstehenden Soziologie
2. Entkoppelung von System und Lebenswelt
VII. Talcott Parsons: Konstruktionsprobleme der Gesellschaftstheorie
1. Von der normativistischen Theorie des Handelns zur Systemtheorie der Gesellschaft
2. Entfaltung der Systemtheorie
3. Theorie der Moderne
VIII. Schlußbetrachtung: Von Parsons über Weber zu Marx
1. Ein Rückblick auf Max Webers Theorie der Moderne
2. Marx und die These der inneren Kolonialisierung
3. Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie
Literaturverzeichnis
Namenregister
Theorie des kommunikativen Handelns
Band I: Handlungsrationalität und gesell. Rationalisierung. Band II: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft
Buch (Taschenbuch)
38,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Details
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
30.01.1995
Verlag
SuhrkampSeitenzahl
1216
Maße (L/B/H)
18,3/11/6,1 cm
Die
Theorie des kommunikativen Handelns
dient der Klärung der Grundlagen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Der Grundbegriff des kommunikativen Handelns erschließt den Zugang zu drei Themenkomplexen, die miteinander verschränkt sind: zum Begriff der kommunikativen Rationalität, zu einem zweistufigen, die Paradigmen von Handlung und System verknüpfenden Gesellschaftskonzept und zu einem theoretischen Ansatz, der die Paradoxien der Moderne mit Hilfe einer Unterordnung der kommunikativ strukturierten Lebenswelt unter die imperativen verselbständigten, formal organisierten Handlungssysteme erklärt.
Unsere Kundinnen und Kunden meinen
Kritische Supertheorie einer verstehenden Soziologie
Zitronenblau am 19.08.2010
Bewertungsnummer: 678269
Bewertet: Buch (Taschenbuch)
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice