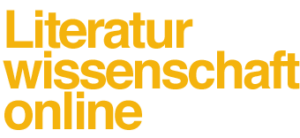Johann Wolfgang Goethe: Dichtung – Kunst – Natur (E-Book)
Prof. Dr. Albert Meier
Italienische Wende
… daß ich im Paradiese war …
An Herzog Carl August, 17./18. 3. 1788
Am 25. Oktober 1788, ein knappes halbes Jahr nach seiner Rückkehr aus Rom, schreibt Goethe an Karl Ludwig von Knebel, es gehe ihm in Weimar »nun gar wie dem Epimenides[1] nach seinem Erwachen«.[2] Dieser Selbstvergleich mit dem legendären Philosophen auf Kreta, der 57 Jahre in einer Höhle verschlafen haben soll, deutet eine Entfremdung von der Heimat an, die Goethe im Rückblick von 1817 auch bestätigt: »Aus Italien dem formreichen war ich in das gestaltlose Deutschland zurückgewiesen, heiteren Himmel mit einem düsteren zu vertauschen; […] ich vermißte jede Theilnahme, niemand verstand meine Sprache«.[3] Beinahe 21 Monate im Süden scheinen eine tiefgreifende Veränderung bewirkt zu haben:
Sein Betragen ist gar sonderbar. […] Die Schardt erzählte mir hernach, daß er den Tag vorher auf dem tanzenden Picknick mit keiner gescheidten Frau ein Wort beinah geredet, sondern den Fräuleins nach der Reihe die Hände geküßt, ihnen schöne Sachen gesagt und viel getanzt hätte. Die Kalbin findet das nun abscheulich, daß er die jungen Mädchen auf diese Weise reizt etc. Kurz, er will durchaus nichts mehr für seine Freunde sein. […] Für Weimar taugt er nicht mehr; im Gegentheil glaube ich, daß das Gelecke an den jungen Mädchen dem Herzog, der dabei war, nicht eben die besten Eindrücke gibt.[4]
Goethes Unbesorgtheit in eroticis mag in dem seit Juli 1788 bestehenden Verhältnis mit Christiane Vulpius gründen und gehört doch schon zum frühen Ertrag seiner mediterranen Kur: »Wie moralisch heilsam ist mir es dann auch, unter einem ganz sinnlichen Volcke zu leben, über das so viel Redens und Schreibens ist, das jeder Fremde nach dem Maasstabe beurtheilt den er mitbringt«.[5] Offenbar hat Italien das Vorhaben, die eigene »Existenz ganzer zu machen«,[6] rundum gelingen lassen und Goethe geholfen, die »Falten« in seinem Gemüt »wieder auszutilgen«:[7] »Die Hauptabsicht meiner Reise war: mich von den phisisch moralischen Übeln zu heilen die mich in Deutschland quälten und mich zuletzt unbrauchbar machten«.[8] Die Hoffnung, »auf eine lange Stockung wieder eine Lebensregung«[9] zu spüren, erfüllt sich allerdings erst während des Zweiten Aufenthalts in Rom zur Gänze, als der ›Künstlerbursche‹[10] die Wohngemeinschaft[11] am Corso »wie der Fisch im Wasser«[12] genießt. Goethe muss in den folgenden Monaten zwar einsehen, es keinem Maler oder Bildhauer wirklich gleichtun zu können,[13] findet demgegenüber aber zur Gewissheit, als Dichter ebenfalls ›Künstler‹ zu sein,[14] d. h. der Kontrapunkt zum Menschenschlag ›Minister‹, wie ihn der zur selben Zeit abgeschlossene Torquato Tasso illustriert.
Wie Goethe Italien erlebt hat, wissen wir in der Hauptsache jedoch nicht aus zeitnahen Dokumenten: Die Italienische Reise ist als ›Zweyte Abtheilung‹ des Autobiografie-Projekts Aus meinem Leben in gut 25-jähriger Distanz entstanden und liegt sogar erst 1829 vollständig vor.[15] Viele Briefe in die Heimat sind dieser verspäteteten Ausarbeitung ebenso zum Opfer gefallen wie das Gros der Reise-Notizen, und allein das Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein[16] gibt in Verbindung mit einigen Originalbriefen einen halbwegs unvermittelten Eindruck von Goethes erster Reaktion auf sein Sehnsuchtsland.
Anders als den deutschen Italienreisenden vor ihm ist es Goethe weniger um das Kennenlernen des ganzen Landes als um den Aufenthalt in Rom gegangen. Sein Vater Johann Caspar Goethe hat 1740 die wichtigsten Städte Italiens im Rahmen einer grand tour besichtigt;[17] Johann Wolfgang Goethe macht sich die Studienreise demgegenüber zum Bildungserlebnis:
Immer muß ich wiederhohlen: ich glaubte wohl hier etwas rechts zu lernen, daß ich aber soweit in die Schule zurückgehen müßte glaubt ich nicht, und je mehr ich mich selbst verläugnen muß je mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeister der einen Thurm aufführen wollte und ein schlechtes Fundament gelegt hatte; er wird es noch bey Zeiten gewahr und bricht gerne wieder ab, was er schon aus der Erde gebracht hat, um sich seines Grundes mehr zu versichern und freut sich schon im Voraus der gewissern Festigkeit seines Baues.[18]
Seine Rom-Erfahrung hat Goethe von Anfang an dem pietistischen Stichwort einer ›Wiedergeburt‹[19] unterstellt. So wie der Gläubige nach langem Bußkampf seinen Durchbruch zur Heilsgewissheit erfährt, so will der Dichter in und durch Italien zu einem neuen Menschen werden und befreit sich in diesem Interesse mit einem Schlag aus allen Weimarer Bindungen bzw. Verpflichtungen: »D. 3. Sept. früh 3 Uhr stahl ich mich aus dem Carlsbad weg«.[20] Sein zunächst in herkömmlichen Bahnen verlaufender Weg führt den »nordischen Flüchtling«,[21] der sich des eigenen Abstands zur mediterranen Lebensweise bewusst genug ist, über den Brenner, Verona und Venedig nach Bologna, wo er die übliche Route am 18. Oktober 1786 verlässt: »Ich will nur durch Florenz durchgehn und grade auf Rom. Ich habe keinen Genuß an nichts, biß jenes erste Bedürfniß gestillt ist«.[22] Dass nun nicht mehr Neapel, sondern Rom im Brennpunkt steht, dürfte in erster Linie dem Vorbild Johann Joachim Winckelmanns geschuldet sein, der 1755 der deutschen Provinz entflohen war und in der Ewigen Stadt seine Weltkarriere als Geschichtsschreiber der Bildhauerei im klassischen Altertum gemacht hatte. Winckelmanns Schriften und Briefe zeigen Rom als das Zentrum aller Kunstschönheit, weil die ungemein reichen Sammlungen im Vatikan wie in den vielen Privatpalästen den Werken griechischer Künstler seit jeher ein Asyl bieten. Aus dieser Perspektive ist Italien − und namentlich Rom − zu einem neuen Griechenland aufgestiegen, wo sich die Höchstleistungen der ›Alten‹ bequemer und eindringlicher studieren ließen als im touristisch noch unerschlossenen Mutterland.
Geschmacklich ist Goethe seit seinen Leipziger Zeichenstudien bei Adam Friedrich Oeser von dessen »Evangelium des Schönen, mehr noch des Geschmackvollen und Angenehmen«[23] geprägt. Der einstige Zeichenlehrer auch Winckelmanns, ein »abgesagter Feind des Schnörkel- und Muschelwesens und des ganzen barocken Geschmacks«,[24] hat Goethe seinerzeit eine Art von Rokoko-Klassizismus nahegebracht, dessen Stil-Ideal der ›Gefälligkeit‹ zwar den Meisterwerken der italienischen Renaissance abgelernt ist, nicht minder aber für das antike Griechenland gelten soll. Mit den entsprechenden Erwartungen ist Goethe nach Italien gereist und namentlich durch die Bauten Andrea Palladios in Venedig und Vicenza zunächst bestätigt worden: »Palladio war so von der Existenz der Alten durchdrungen und fühlte die Kleinheit und Enge seiner Zeit, in die er gekommen war, wie ein groser Mensch, der sich nicht hingeben, sondern das Ubrige soviel als möglich nach seinen edlen Begriffen umbilden will«.[25] Charlotte von Stein gegenüber beschreibt Goethe seine Reaktion auf Palladio als »Revolution«, die ihm »ein Gefühl von freyerem Leben, höherer Existenz Leichtigkeit und Grazie«[26] verschafft und zugleich die Möglichkeit eröffnet, von der Konzentration auf das natürlich ›Wahre‹ zum künstlerisch »Grosen überzugehen, das nur der höchste reinste Punckt des Wahren ist«.[27] Während die zahllosen Märtyrer-Gemälde der Kirchen und Museen Italiens wieder und wieder nur den Eindruck erregen, »auf der Anatomie, dem Rabenstein, dem Schindanger«[28] zu sein, erlaubt Palladios Klassizismus eine Kunsterfahrung, in der sich das Natürliche geistig verklärt und alles bloß Wirkliche in Schönheit transzendiert.
Als erstes vollständig erhaltenes Baudenkmal des Altertums sieht Goethe den Minerva-Tempel im umbrischen Assisi, der seinen Leipziger Vorstellungen von antiker Schönheit noch vollkommen Recht zu geben scheint: »Am Tempel (der Façade versteht sich) hab ich die größte Freude gehabt meine Ideen und Grundsätze bestärckt zu sehn«.[29] Dass es sich dabei um ein römisches, nicht aber griechisches Bauwerk handelt, wie allein schon die korinthischen Säulen kenntlich machen, lässt umso besser verstehen, warum schließlich die auf das 6./5. Jh. v. Chr. zurückgehenden Tempel im kalabrischen Paestum − die ersten Zeugen einer genuin griechischen Kultur − Goethes Rokoko-Klassizismus im März 1787 derart irritieren:
Ich befand mich in einer völlig fremden Welt. Denn wie die Jahrhunderte sich aus dem Ernsten in das Gefällige bilden, so bilden sie den Menschen mit, ja sie erzeugen ihn so. Nun sind unsere Augen und durch sie unser ganzes inneres Wesen an schlankere Baukunst hinangetrieben und entschieden bestimmt, so daß uns diese stumpfen, kegelförmigen, enggedrängten Säulenmassen lästig, ja furchtbar erscheinen.[30]
In ihrer dorischen Wucht und Schwerfälligkeit[31] sind die drei Tempel von Paestum tief verstörend, da sie Winckelmanns Idealisierung der griechischen Antike als heiterer Jugendphase der Menschheit so eklatant widersprechen. Nicht nur in ästhetischer, sondern mehr noch in ethischer Hinsicht ereignet sich Goethes Konfrontation mit dem authentischen Griechentum daher als Schock. Der Schüler Oesers hat Palladio als Wiedergeburt eines antiken Griechen verstanden und muss nun erfahren, dass das echte Altertum mit neuzeitlicher Gefälligkeitsästhetik nichts zu schaffen gehabt hat.
Wenigstens Sizilien, das Goethe im Frühjahr 1787 bereist, soll daraufhin das Versprechen antiker Schönheit einlösen und scheint dem Erwartungsdruck zunächst sogar standgehalten zu haben. Jedenfalls muss der erste Anblick der Nordküste vom Schiff aus überwältigend gewesen sein:
Mit keinen Worten ist die dunstige Klarheit auszudrücken, die um die Küsten schwebte als wir am schönsten Nachmittage gegen Palermo anfuhren. Die Reinheit der Conture, die Weichheit des Ganzen, das Auseinanderweichen der Töne, die Harmonie von Himmel, Meer und Erde. Wer es gesehen hat der hat es auf sein ganzes Leben. Nun versteh’ ich erst die Claude Lorrain und habe Hoffnung, auch dereinst in Norden aus meiner Seele Schattenbilder dieser glücklichen Wohnung hervor zu bringen. Wäre nur alles Kleinliche so rein daraus weggewaschen als die Kleinheit der Strohdächer aus meinen Zeichenbegriffen.[32]
In diesen Sätzen der Italienischen Reise ist das ganze Programm einer Klassik für Weimar schon enthalten: die Übertragung südlicher Schönheit nach Norden im vollen Bewusstsein, es dort doch nur zu ›Schattenbildern‹ zu bringen. Aber auch Sizilien hält letztlich nicht, was Goethe sich von diesem »Schlüssel zu Allem«[33] versprochen hat. Statt als Heimat eines immer noch lebendigen Griechentums zeigt sich ihm die »Königin der Inseln«[34] vielmehr als Ort von Naturgewalt und schlechtem Geschmack. In Messina stehen Goethe zuletzt die Verwüstungen des jüngsten Erdbebens (1783) vor Augen, und schon am 9. April 1787 hat ihn die spätbarocke Villa des Fürsten Palagonia nahe Palermo mit einem eklatanten Widerspruch zur klassizistischen Formvollendung konfrontiert:
Der Weg nach dem Schlosse zu ist breiter als gewöhnlich, die Mauer in einen fortlaufenden hohen Sockel verwandelt, auf welchem ausgezeichnete Basamente seltsame Gruppen in die Höhe tragen […]. Das Widerliche dieser von den gemeinsten Steinhauern gepfuschten Mißbildungen wird noch dadurch vermehrt, daß sie aus dem losesten Muscheltuff gearbeitet sind; doch würde ein besseres Material den Unwerth der Form nur desto mehr in die Augen setzen.[35]
Denke man sich nun dergleichen Figuren schockweise verfertigt und ganz ohne Sinn und Verstand entsprungen, auch ohne Wahl und Absicht zusammengestellt, […], so wird man das unangenehme Gefühl mit empfinden das einen jeden überfallen muß, wenn er durch diese Spitzruthen des Wahnsinns durchgejagt wird.[36]
Das Widersinnige einer solchen geschmacklosen Denkart zeigt sich aber im höchsten Grade darin, daß die Gesimse der kleinen Häuser durchaus schief nach einer oder der andern Seite hinhängen, so daß das Gefühl der Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigentlich zu Menschen macht und der Grund aller Eurythmie ist, in uns zerrissen und gequält wird.[37]
Wer nach einer prägnanten Begründung für den Weimarer Klassizismus − für das entschiedene Interesse an ästhetischer Normativität − verlangt, kann keinen drasti-scheren Beleg finden als diese Abscheu vor den palagonischen Grotesken. Goethes Widerwille ist jedenfalls keine bloße Geschmacksäußerung, sondern im Kern sittlich motiviert: als Zurückschrecken vor der Missachtung jeder vernünftigen Ordnung, jeder natürlichen Grenze. Wenn »Sicilien und Neugriechenland« dennoch »wieder ein frisches Leben hoffen«[38] lassen, dann erst in der Abkehr von der Lebenswelt im Süden. Was der einst griechisch kolonisierte mezzogiorno nicht leisten kann, das findet Goethe umso mehr während seines ca. einjährigen ›Zweiten römischen Aufenthalts‹ als dem Widerpart zur Magna Graecia.
Diese Zeit am Corso − die Studien in den Kunstsammlungen Roms, die eigenen Zeichen- und Mal-Übungen im Kreis der deutschrömischen Künstler, das sorglose Leben ohne berufliche Pflichten und die Gespräche über eine grundlegend neue Ästhetik namentlich mit Karl Philipp Moritz – legt die Grundlagen dafür, die mediterrane Kultur soweit als möglich für die nordische Heimat zu retten und dort einen künstlerischen Neubeginn zu wagen. Goethe hat offenbar nie ernsthaft daran gedacht, auf Dauer in Italien zu bleiben. Vielmehr überführt er die Ernte seines Lebens im Süden nach Weimar, das langsam − privat wie öffentlich − zu einem Rom alla tedesca umgestaltet wird. Besonders augenfällig ist diese Absicht am Römischen Haus, einem auf Goethes Anregung hin für Herzog Carl August errichteten Gartenhaus über dem Ilm-Park. Dem Bauprogramm sind Goethes italienische Erfahrungen eingeschrieben: In klassizistischer Schlichtheit zeigt die ionisch gestaltete Fassade diejenige Leichtigkeit, die die Tempel von Paestum so schmerzhaft vermissen ließen; an seiner Hangseite aber ist das Römische Haus auf dorische Säulen gestützt, über die sich die entschieden ›palladianische‹ Schönheit des eigentlichen Gebäudes umso gültiger erhebt.
Fußnotenapparat
[1] Vgl. Goethes spätere Dramatisierung: Des Epimenides Erwachen. Ein Festspiel von Göthe. Berlin, bei Duncker und Humblot. MDCCCXV.
[2] Goethe an Carl Ludwig von Knebel, 25. 10. 1788. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 9. Band: Weimar, Oberitalien, Schlesien, Weimar. 18. Juni 1788 – 8. August 1792. Weimar. Hermann Böhlau. 1891, S. 43f., hier S. 43.
[3] Johann Wolfgang Goethe: Schicksal der Handschrift. In: Zur Morphologie. Von Goethe. Erster Band [Erstes Heft]. Stuttgard und Tübingen, in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 63–68, hier S. 63.
[4] Caroline Herder an Johann Gottfried Herder (14. 11. 1788). In: Herders Reise nach Italien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin, vom August 1788 bis Juli 1789. Herausgegeben von Heinrich Düntzer und Ferdinand Gottfried von Herder. Gießen, 1859. J. Ricker’sche Buchhandlung, S. 169–173, hier S. 170f.
[5] Johann Wolfgang Goethe an den Freundeskreis in Weimar (1. 11. 1786). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 37–39, hier S. 38.
[6] Johann Wolfgang Goethe an Herzog Carl August (2. 9. 1786). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 11–14, hier S. 13.
[7] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau1887, S. 143–331, hier S. 175 [Trient, 11. 9. 1786].
[8] Johann Wolfgang Goethe an Herzog Carl August (25. 1. 1788). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 324–336, hier S. 327.
[9] Johann Wolfgang Goethe an Johann Gottfried und Caroline Herder (2.[–9.] 12. 1786). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 75–78, hier S. 77.
[10] Vgl. die Bemerkung Herders in einem römischen Brief an seine Frau Caroline (11. 10. 1788), Goethe habe »wie ein Künstlerbursche hier gelebet« (Herders Reise nach Italien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin, vom August 1788 bis Juli 1789. Herausgegeben von Heinrich Düntzer und Ferdinand Gottfried von Herder. Gießen, 1859. J. Ricker’sche Buchhandlung, S. 118–123, hier S. 121).
[11] Vgl. Johann Heinrich Wilhelm Tischbeins Zeichnung von Goethe mit Karl Philipp Moritz, die einen offenbar heiteren Augenblick dokumentiert.
[12] Johann Wolfgang Goethe: Zweyter Römischer Aufenthalt vom Juny 1787 bis April 1788. In: Goethe’s Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Neunundzwanzigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung. 1829, S. 10 [Rom, Ende Juni 1787].
[13] »Zur bildenden Kunst bin ich zu alt, ob ich also ein bißchen mehr oder weniger pfusche ist eins« (Johann Wolfgang Goethe: Zweyter Römischer Aufenthalt vom Juny 1787 bis April 1788. In: Goethe’s Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Neunundzwanzigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung. 1829, S. 278 [Rom, 6. Februar 1788]).
[14] »Ich darf wohl sagen: ich habe mich in dieser anderthalbjährigen Einsamkeit selbst wiedergefunden; aber als was? − Als Künstler!« (Johann Wolfgang Goethe an Herzog Carl August (17./18. 3. 1788). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 355–362, hier S. 357).
[15] 1) Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Erster Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1816. / 2) Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817. / 3) Johann Wolfgang Goethe: Zweyter Römischer Aufenthalt vom Juny 1787 bis April 1788. ›Longa sit huic aetas, dominaeque potentia terrae, | Sitque sub hac oriens occiduusque dies.‹ In: Goethe’s Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Neunundzwanzigster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung. 1829.
[16] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 143–331.
[17] Johann Caspar Goethe: Reise durch Italien im Jahre 1740 (Viaggio per l’Italia). Vollständige Ausgabe. Aus dem Italienischen übersetzt und kommentiert von Albert Meier unter Mitarbeit von Heide Hollmer. Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1986. – Das Original-Manuskript in italienischer Sprache befindet sich in der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek Weimar.
[18] Johann Wolfgang Goethe an Charlotte von Stein (29.[–30.] 12. 1786). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 105–107, hier S. 105.
[19] »[…] und ich zähle einen zweyten Geburtstag, eine wahre Wiedergeburt von dem Tage da ich Rom betrat« (Johann Wolfgang Goethe an Johann Gottfried und Caroline Herder (2.[–9.] 12. 1786). In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. IV. Abtheilung: Goethes Briefe. 8. Band: Italiänische Reise. August 1786 – Juni 1788. Weimar. Hermann Böhlau. 1890, S. 75–78, hier S. 77).
[20] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 147.
[21] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 277.
[22] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 303.
[23] Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Von Goethe. Zweyter Theil. Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Tübingen, in der J. G. Cottaischen Buchhandlung. 1812, S. 244.
[24] Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Von Goethe. Zweyter Theil. Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle. Tübingen, in der J. G. Cottaischen Buchhandlung. 1812, S. 233.
[25] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 257.
[26] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 251.
[27] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 251.
[28] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 307.
[29] Johann Wolfgang Goethe: Tagebuch der Italiänischen Reise für Frau von Stein. In: Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abtheilung: Goethes Tagebücher. 1. Band: 1775 – 1787. Weimar. Hermann Böhlau. 1887, S. 324.
[30] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 114.
[31] Am besten nachzuempfinden ist Goethes ästhetische Erschütterung anhand der 1778 entstandenen Kupferstiche Giovanni Battista Piranesis.
[32] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 144f.
[33] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 198.
[34] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 145.
[35] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 176f.
[36] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 179.
[37] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 180f.
[38] Aus meinem Leben. Von Goethe. Zweyter Abtheilung Zweyter Theil. Auch ich in Arcadien! Stuttgard und Tübingen, in der Cotta’schen Buchhandlung. 1817, S. 192.