
Jennifer Lopez als und in „Atlas“. Foto: Netflix
Oje. Das Originellste in diesem Film ist ein schöner Name im Abspann: Ein Produktionsmanager heißt „Samson Mücke“. Aber bevor man den Abspann erreicht, verbringt man zwei Stunden mit einem merkwürdig mittelmäßigen Film: „Atlas“ ist weder spannend noch völlig langweilig, sichtlich aufwändig, dabei aber optisch wenig originell – irgendwie hat man alles schon mal gesehen. Um Künstliche Intelligenz geht es – und wäre es nicht selber schon als Kritik-Klischee so abgegriffen, könnte man einwenden, dass der Film vielleicht interessanter geworden wäre, hätte man KI herangelassen. (Oder man tat es, was angesichts des Ergebnisses dann aber ziemlich enttäuschend wäre.)
KI-Schurke „Harlan“
Hektische, drastische Nachrichtenbilder klären uns zu Beginn auf, dass es mit der Welt nicht zum Besten steht. Die KI der Welt rebelliert gegen den Menschen, humanoide Robot-Gestalten greifen zu den Waffen, Millionen wirkliche Menschen sterben, bis sich eine „International Coalition of Nations“ (ICN) gründet und dagegenhält. Der Oberkopf der KI flieht auf einen fernen Planeten und verkündet aus dem Exil eine pathetische Botschaft, die nahelegt, dass er zu viele schlechte Drehbücher gespeichert hat: „Ich werde zurückkommen, um das zu vollenden, was ich angefangen habe. Das ist der einzige Weg.“ Der Name des überbösen KI-Bosses ist „Harlan“ – ob die Drehbuchautoren dabei an den berüchtigten NS-Filmregisseur Veith Harlan dachten, ist unwahrscheinlich, wäre aber eine originelle Idee.
Ohne Espresso geht es nicht
Flugs springt der Film von Brad Peyton („San Andreas“, „Rampage“) 28 Jahre weiter und stellt seine Haupt- und Titelfigur vor: Atlas (Jennifer Lopez), eine Analystin der ICN mit meist schlechter Laune, vor allem, wenn sie nicht ihre vierfache Morgendosis Espresso bekommt. Damit man weiß, wie intelligent Atlas ist, lässt der Film sie zumindest anfangs Brille tragen (wie Wissenschaftlerinnen in SF-Filmen der 1950er Jahre) und einen Schachcomputer im Vorbeigehen mattsetzen. Ihre Lebensmission ist der Kampf gegen die KI, was biografische Gründe hat, die im Laufe des Films recht tränenselig aufgeblättert werden. Einem gefangenen KI-Roboter entlockt sie das Geheimnis, auf welchem Planeten sich Harlan versteckt. Ein Kriegsschiff macht sich auf ins All, Atlas ist als Zivilistin dabei und verteilt den militärischen Kolleginnen und Kollegen Informationen per Papierausdruck – im 24. Jahrhundert eher ungewöhnlich, aber Atlas misstraut der digitalen Vernetzung und setzt aufs Analoge.
Bunt und öde: „Heart of Stone“ bei Netflix
Nach einer Raumschlacht, so rasant wie unübersichtlich, die eher wie ein PC-Spiel denn eine Spielfilmsequenz ausschaut, ist Atlas die letzte Hoffnung der Menschheit; über die Oberfläche des fernen Planeten stapft sie in einem Ganzkörper-Roboteranzug, mitbedient von einer Künstlichen Intelligenz. Die bittet Atlas, sich mit ihr mental zu verschmelzen (in Form eines Art Ohrhörers), um eine unschlagbare Mensch-Maschine-Kombination zu werden. Aber Atlas weigert sich. Erstmal.
Das Analoge gegen das Digitale
Das ist der Grundplot – Mensch contra Maschine, das Analoge gegen das Digitale, wahre Gefühle gegen Pseudo-Emotionen aus dem Rechner. Ein ziemlich drängendes und aktuelles Thema. Doch „Atlas“ macht überraschend wenig daraus. Die interessante Frage, ob die menschliche DNA auch nicht mehr ist als ein Code aus dem PC und ob wir damit auch nicht komplexer (oder freier) sind als ein schnöder Rechner, wird mal angesprochen, aber halbherzig. Zu komplex soll es wohl nicht werden in diesem Star-Vehikel für Jennifer Lopez, in dem sie die lange Zeit in einem Robot-Panzer sitzt, mit einer KI namens „Smith“ spricht oder sich von der Maschine ein gebrochenes Bein richten lässt (eine so originelle wie ruppige Szene). Diese Momente sind die besten des Films, während ansonsten bunte Langeweile dominiert. Erstaunlich ist, mit wie wenig Fantasie man an die Darstellung von KI herangeht: Der Bösewicht, die Ober-Intelligenz, hat sich auf dem Fluchtplaneten eine Welt zusammengebaut, die von außen wie ein Einkaufszentrum ausschaut, und schmiedet einen Plan wie ein Bösewicht bei James Bond in den späten 1970ern: Er will die Welt vernichten und Mutter Erde neu beginnen lassen – denn der Mensch, da hat Harlan ja nicht Unrecht, sei durch ihre Kriege und Umweltzerstörung eine zu große Bedrohung. Das Ende der Welt kann Atlas nicht zulassen, und so steuert der Film in ein Actionfinale, in dem sogar so etwas wie ein „Star Wars“-Lichtschwert zum Einsatz kommt. Das kann man nun „Hommage“ nennen – oder auch den Gipfel der Einfallslosigkeit.
Wie steht der Film zum Thema KI? Die Figur Atlas gibt sich ja lange skeptisch und abweisend, aber letztendlich unterscheidet der Film zwischen böser KI (interessanterweise verkörpert von einem Darsteller mit asiatischem Antlitz) und guter KI. Die findet sich unter anderem in amerikanischen Kriegsgerät, sehr zur Freude von Atlas, die am Ende nicht nur die familiären Traumata besiegt hat, sondern auch ein karrierechnisches: Denn zwar ist sie Analystin, aber eigentlich wollte sie doch immer zum Militär. Da wird der Film ideologisch durchaus gruselig.
„Atlas“ kann man bei Netflix sehen, muss man aber nicht.

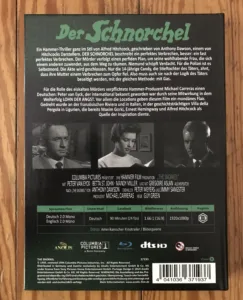






















Neueste Kommentare