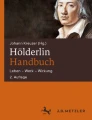Zusammenfassung
Einer Prosa-Einleitung zufolge, die sich in einigen Handschriften des Textes findet, scheint Sanāʾī gestorben zu sein, bevor er das Werk vollenden konnte, welches sein berühmtestes und einflussreichstes Gedicht werden sollte, ein didaktisch-ethisches ‚mathnawi‘ (Gedicht mit reimenden Halbversen). Dieser Sachverhalt würde die großen Unterschiede erklären, die schon ab dem späten 12. Jh. in Länge und Anordnung der verschiedenen Handschriften bestehen. Tatsächlich war dieses Gedicht über die längste Zeit seiner Geschichte (bis zu und einschließlich der Edition von 1950) in einer langatmigen Version von mehr als 10 000 Versen bekannt, eingeteilt in zehn Kapitel und mit zahlreiche illustrativen Anekdoten durchsetzt, aber weit davon entfernt, Sanāʾīs Werk zu sein.
Ursprünglich veröffentlicht unter © J.B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH
Similar content being viewed by others
neupersisch
FormalPara Freie Übersetzung des TitelsDer Garten der Wahrheit und das Gesetz des Weges
FormalPara HauptgattungEpik / Prosa
FormalPara UntergattungEpos
Einer Prosa-Einleitung zufolge, die sich in einigen Handschriften des Textes findet, scheint Sanāʾī gestorben zu sein, bevor er das Werk vollenden konnte, welches sein berühmtestes und einflussreichstes Gedicht werden sollte, ein didaktisch-ethisches ‚mathnawi‘ (Gedicht mit reimenden Halbversen). Dieser Sachverhalt würde die großen Unterschiede erklären, die schon ab dem späten 12. Jh. in Länge und Anordnung der verschiedenen Handschriften bestehen. Tatsächlich war dieses Gedicht über die längste Zeit seiner Geschichte (bis zu und einschließlich der Edition von 1950) in einer langatmigen Version von mehr als 10 000 Versen bekannt, eingeteilt in zehn Kapitel und mit zahlreiche illustrativen Anekdoten durchsetzt, aber weit davon entfernt, Sanāʾīs Werk zu sein.
Es existiert jedoch eine auf 1157 datierte, d. h. wenige Jahrzehnte nach Sanāʾīs Tod entstandene Handschrift, die nur ca. 5000 Verse enthält und als Faḫrīnāma betitelt ist. Diese Handschrift wurde als Grundlage für eine neue Edition benutzt. Sie gibt einen besseren Eindruck davon, was Sanāʾī beabsichtigt haben muss (obwohl aus der erwähnten Prosa-Einleitung hervorgeht, dass er selbst mit der Arbeit an einer anderen, längeren Version begonnen hatte). Das Faḫrīnāma gibt keinen Anlass mehr, das Werk literarisch negativ zu bewerten, was einige westliche Wissenschaftler im Hinblick auf die längere Version getan haben; im Osten war deren Weitschweifigkeit nie ein Hindernis für große Popularität, ganz im Gegenteil.
Das Faḫrīnāma „erscheint als eine kontinuierliche Predigt mit vielen verschiedenen spirituellen Themen“ (de Bruijn). Die erste Hälfte des Textes – ungefähr 2000 Verse – enthält eine Reihe von Lobpreisungen – u. a. das Lob Gottes, des Propheten, der ersten vier Kalifen und des Korans – sowie Abschnitte über eine asketische Lebensweise und eine philosophische Exposition über das Universum und den Menschen. Die eindrucksvolle Beschreibung der Nacht, die im Tagesanbruch endet und in der Erscheinung eines alten Mannes kulminiert, markiert einen wichtigen Übergang im Text. Wie der Greis, der den Protagonisten in Sanāʾīs früherem Mathnawi Sair al-ʿibād ila l-maʿād leitet, muss der alte Mann auch hier als Allegorie für den „Aktiven Intellekt“ verstanden werden, ein Konzept, das unter dem Einfluss der neuplatonischen Philosophie entstanden ist. Es folgt zunächst eine kurze Unterhaltung zwischen dem Dichter und dem Greis und dann eine lange Exposition, die offenkundig als Rede des alten Mannes gedacht ist und die durch eine Menge assoziativ verbundener philosophischer und ethischer Fragestellungen mäandert. Leitmotive sind die Wichtigkeit eines Lebens ohne Bindungen und die Zurückweisung der diesseitigen Welt. Dies führt zu der Schlussfolgerung, dass die Liebe das wesentliche Phänomen des Universums ist. An diesem Punkt, nach annähernd 4000 seiner 5000 Verse, nimmt das Gedicht eine neue Wendung und wird zum Lobgedicht auf den Ghaznavidenkönig Bahrām Šāh – als Exempel für den perfekten islamischen Herrscher – und dessen Sohn Daulat Šāh. Der Titel dieser Version, Faḫrīnāma, könnte auf Bahrām Šāhs Ehrentitel Faḫruddaula (Glorie des Staates) verweisen.
Das Faḫrīnāma enthält nur 45 sehr kurze Anekdoten (und weitere elf im Anhang); die ‚mathnawis‘, die von ihm beeinflusst sind, wie die Werke ʿAṭṭārs, Niẓāmīs Maḫzan al-asrār (12. Jh.) und Rūmīs Mas̱navī-yi maʿnavī (13. Jh.), räumen den Anekdoten weit mehr Platz ein, was zu ihrem Charme beiträgt. Sanāʾīs ‚mathnawi‘ mag anspruchsvoller sein, doch sein elliptischer Stil und manchmal trockener Witz kann den Leser durchaus für sich einnehmen.
Bibliographie
Ausgaben
Ḥadiqat al-ḥaqiqe va šariʿat aṭ-ṭariqe, Hg. M. T. Modarres Reżavi, 1950.
Ḥadiqat al-ḥaqiqe va šariʿat aṭ-ṭariqe (Faḫrināme), Hg. M. Ḥoseyni, 2001.
Übersetzungen
The First Book of the Hadīqatu'l-haqīqat or The Enclosed Garden of the Truth, J. Stephenson, 1911.
Literatur
J. T. P. de Bruijn: Ḥadiqat al-Ḥaqiqa wa Šariʿat al-Ṭariqa, in: Encyclopaedia Iranica, Hg. E. Yarshater, Bd. 11, 2003, 441–442.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Section Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 2020 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature
About this entry
Cite this entry
Beelaert, A.L. (2020). Sanāʾī, Abū l-Maǧd Maǧdūd ibn Ādam: Ḥadīqat al-ḥaqīqa va šarīʿat aṭ-ṭarīqa. In: Arnold, H.L. (eds) Kindlers Literatur Lexikon (KLL). J.B. Metzler, Stuttgart. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_21803-1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_21803-1
Received:
Accepted:
Published:
Publisher Name: J.B. Metzler, Stuttgart
Print ISBN: 978-3-476-05728-0
Online ISBN: 978-3-476-05728-0
eBook Packages: Kindlers Literatur Lexikon (KLL)