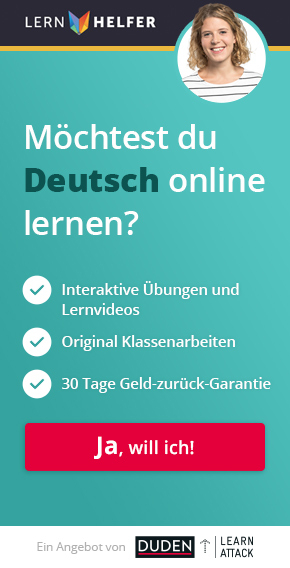Der Steppenwolf
Der 1927 erschienene Roman „Der Steppenwolf“ begründete HESSEs Weltruhm.
Die Gestalt des einsamen Künstlers Harry Haller, des Steppenwolfs, ist eine Identifikationsfigur von enormer Integrationskraft, vor allem unter jungen Lesern.
Hesse-Begeisterung
Die immer wieder auflebende Welle der HESSE-Begeisterung begann wenige Jahre nach HERMANN HESSEs Tod im Amerika der Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Unter den Hippies, Verweigerern des Kriegsdienstes in Vietnam und den LSD-Konsumenten auf ihren psychedelische Trips avancierte „Der Steppenwolf“ zum Kultbuch und erlebte wie der fernöstlicher Philosophie verpflichtete Roman „Siddharta“ immer wieder Phasen intensivster Rezeption.
Thema des Romans
Der Roman „Steppenwolf“ nimmt ein in der deutschen Literatur vielfach gestaltetes Thema auf: das Problem des Fremdseins und des Außenseitertums des Künstlers in der bürgerlichen Gesellschaft. Der Steppenwolf mit seiner Verachtung bürgerlicher Werte einerseits und der Sehnsucht nach dem „Leben“ andererseits verkörpert die Zerrissenheit des Künstler-Ichs. Auch THOMAS MANN hat diesen Konflikt mehrfach gestaltet, ein beeindruckendes Beispiel ist seine Künstlernovelle „Tonio Kröger“ (1903).
Autobiografische Züge
Mit dem „Steppenwolf“, der unverhohlen autobiografische Züge trägt – so sind die Initialen der Hauptfigur Harry Haller dieselben wie HERMANN HESSEs –, arbeitete der Dichter eine eigene schwere Lebenskrise ab, in die er um sein 50. Lebensjahr herum geraten war. Seine ablehnende Haltung dem Ersten Weltkrieg gegenüber hatte ihn in der deutschen Gesellschaft weitgehend isoliert und zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. Seine Ehe und damit die Familie waren zerbrochen und er lebte sehr einsam an der Schwelle zum Alter im schweizerischen Tessin. In der Fixierung auf seine geistigen Vorbilder und seinen Intellektualismus hat er sich weiter in die Isolierung und die geistige Krise treiben lassen und nur schwer unter den „Allerweltsmenschen“ Fuß fassen können. Er, der vertraut war mit der Lehre des Psychologen C.G. JUNG, suchte selbst Hilfe bei dessen Schüler Dr. Lang und hat die jungsche Tiefenpsychologie im „Steppenwolf“ vor allem in den Sequenzen des „Magischen Theaters“ verarbeitet. Für HESSE hatte der Roman letztlich die Funktion einer „Katharsis“, denn dadurch vermochte er den dunklen, verleugneten Seiten seines Selbst Ausdruck zu geben und als Teil seiner Persönlichkeit anzuerkennen.
Ablehnung und Bewunderung
Das Buch hat bei seinem Erscheinen bei einem Teil der HESSE-Jünger heftige Ablehnung hervorgerufen; diese Art hässlicher, gefährlicher Töne war man von dem Autor der Innerlichkeit und romantischen Empfindsamkeit nicht gewöhnt. Größer war jedoch die Zahl der Bewunderer dieser experimentellen Prosa, zu ihr gehörten die großen Schriftsteller der Zeit, etwa THOMAS MANN, der den „Steppenwolf“ mit JAMES JOYCE' „Ulysses“ verglich.
Romanaufbau
HESSE hat die auf den ersten Blick sehr disparat wirkenden Teile des Romans nach eigener Aussage wie die Sätze einer Sonate komponiert. Und in der Tat ergeben sie ein Zusammenspiel der Themen und Motive.
Das „Vorwort des Herausgebers“ fungiert gewissermaßen als Exposition und macht mit der hoch komplizierten Persönlichkeit des Ich-Erzählers Harry Haller bekannt. Der fiktive Herausgeber, der Neffe von Hallers Zimmerwirtin, ist ein Vertreter der kleinen, einfachen bürgerlichen Welt, zu der Harry Haller eine unüberbrückbare Fremdheit empfindet. Nicht zuletzt bestimmt dieser Herausgeber die Position des Rezipienten, des Lesers, der sehr wohl Sympathien für den unglücklichen Steppenwolf empfindet, andererseits aber auf die Sicherheit seines behaglichen, von Pflichten erfüllten bürgerlichen Lebens vertrauen kann. Somit ist der Leser eingestimmt auf die Darstellung der „Seelenkrankheit“ des Steppenwolfs, die zugleich als „Krankheit der Zeit“ diagnostiziert wird.
„Harry Hallers Aufzeichnungen“, in der Funktion der Durchführung des Sonatensatzes, geben Aufschluss über seine innere Zerrissenheit und sein schwieriges Verhältnis zur Gesellschaft, an deren Rand er lebt. Harry Haller nennt sich selbst den Steppenwolf, denn er ist, um die 50, ein völlig vereinsamter Mensch, der sich in sein angemietetes Zimmer zurückzieht, um die Heroen des Geistes, die „Unsterblichen“, allen voran GOETHE, zu studieren. Er verabscheut die bürgerliche Mittelmäßigkeit und Sattheit der „Dutzendmenschen“ und sehnt sich andererseits nach deren alltäglichen einfachen Freuden. Harry Haller ist als Persönlichkeit zerfallen, er sieht sich selbst als Mischwesen aus Mensch und Wolf, die sich in seinem Innern befehden. Einerseits ist das ungezähmte, ungesellige Wolfswesen, andererseits das hoch sensible, den Künsten und der Philosophie lebende Menschenwesen in ihm. Nachts streift er unruhig durch die Stadt und ihre Kneipen und erhält am Eingang zum Magischen Theater („Nur für Verrückte“) von einem Bauchladenverkäufer den „Tractat vom Steppenwolf“, der ihn theoretisch aufklärt über das Wesen des Steppenwolfs. Der objektive „Tractat“, in anderem Druckbild in die tagebuchartigen Aufzeichnungen des Ich-Erzählers eingeschoben (Montagetechnik), korrigiert sein zweipoliges Selbstbild insofern, als er auf der Vielschichtigkeit seiner Persönlichkeit beharrt und ihm klarmacht, dass er sein Leben ändern muss.
„Sein Leben schwingt (wie jedes Menschen Leben) nicht bloß zwischen zwei Polen, etwa dem Trieb und dem Geist, oder dem Heiligen und dem Wüstling, sondern es schwingt zwischen tausenden, zwischen unzählbaren Polpaaren.“
(Hesse, Hermann: Der Steppenwolf. Frankfurt/Main: Suhrkamp Verlag, 1974, S. 48)
Der „Tractat vom Steppenwolf“ als Bindeglied zwischen den zwei Romanteilen nimmt als Reprise alle wichtigen Motive noch einmal auf und eröffnet Lösungsmöglichkeiten für Harry Hallers Lebensüberdruss. Sie weisen vor allem darauf, dass der Steppenwolf im Wunsch nach Einheit seiner Persönlichkeit nicht seine Seele vereinfache und verenge, sondern die Welt in seine „schmerzlich erweiterte Seele aufnehmen“ müsse.
„Sonatenhauptsatz“
Im zweiten Abschnitt von Hallers Aufzeichnungen wird der „Sonatenhauptsatz“ durchgeführt, indem Haller Figuren begegnet, die gewissermaßen die in ihm angelegten Möglichkeiten verkörpern und ihm helfen sollen, sie zu erkennen und zu verwirklichen. In der tiefsten Verzweiflung und zum Selbstmord bereit, nachdem der Besuch bei einem Professor im Eklat endete, begegnet der Steppenwolf dem Animiermädchen Hermine. Sie führt ihn in die Halbwelt der Großstadt ein und lehrt ihn so alltägliche Freuden wie das Tanzen. Durch sie lernt er Maria kennen, mit der er eine beglückende erotische Erfahrung macht, und den Saxophonisten Pablo, dessen lächelnde Gleichgültigkeit er bald als Toleranz, Lebensklugheit und Menschenkenntnis zu schätzen weiß. In Begleitung Hermines, die mütterlich, aber auch schön und jung und in ihrem Wesen ihm ähnlich ist, versucht er, aus dem Gefängnis seiner Persönlichkeit auszubrechen. Sie macht ihn auf seine einseitige Lebenserfahrung aufmerksam, auf die Vielfalt seiner inneren, lebendigen, bislang verleugneten Möglichkeiten. Sie ist für ihn wie ein Spiegelbild.
„Der Steppenwolftractat und Hermine hatten recht mit ihrer Lehre von den tausend Seelen,“ (ebenda S. 112)
HESSE bemüht also nicht nur eine literarische Gestalt, Hermine, sondern auch, und das ist überraschend, eine literarische Form, den Traktat, damit des Autors Alter ego zur Selbsterkenntnis gelangt:
„täglich zeigten sich neben all den alten noch einige neue Seelen in mir, machten Ansprüche, machten Lärm und ich sah nun deutlich wie ein Bild vor mir den Wahn meiner bisherigen Persönlichkeit“. (ebenda S. 112)
Diese sehr spezielle Reise ins Ich scheint gelungen:
„ein sehr zart ausgebildeter Spezialist für Dichtung, Musik und Philosophie - den ganzen Rest meiner Person, das ganze übrige Chaos von Fähigkeiten, Trieben, Strebungen hatte ich als lästig empfunden und mit dem Namen Steppenwolf belegt.“ (ebenda S. 112)
Doch Harry Haller kann seinen lebensuntüchtigen Intellektualismus nicht ohne weiteres überwinden. Hermine macht nicht allein seine neurotische Persönlichkeitsstruktur dafür verantwortlich, sein Unvermögen, das Streben nach hohen Idealen mit der banalen Realität zu versöhnen. Sie benennt seine Probleme auch als ein Symptom der Zeit:
„Du bist für diese einfache, bequeme, mit so wenigem zufriedene Welt von heute viel zu anspruchsvoll und hungrig, sie speit dich aus, du hast für sie eine Dimension zuviel. “ (S. 133)
Solche Sätze waren und sind es, die vor allem junge Leute immer noch HESSE lesen lassen. Diese Gedanken klingen zeitlos:
„ Wer heute leben und seines Lebens froh werden will, der darf kein Mensch sein wie du und ich. Wer statt Gedudel Musik, statt Vergnügen Freude, statt Geld Seele, statt Betrieb echte Arbeit, statt Spielerei echte Leidenschaft verlangt, für den ist diese hübsche Welt hier keine Heimat …“ (S. 133)
Das Magische Theater
Um Harry am Ende dennoch mit den verleugneten Seiten seiner Persönlichkeit bekannt zu machen, bedarf es einer Art zauberhaften Rituals. Harry Haller gelangt in das Magische Theater („– nur für Verrückte – Eintritt kostet den Verstand“), wo er auch seinen Freunden wieder begegnet. Er findet die sinnliche Maria und Pablo, den hingebungsvollen Musiker mit dem schönen „Tierblick“. Hermine, die ihn nun an seinen Jugendfreund Hermann erinnert, erscheint ihm als hermaphroditisches Wesen und gibt sich damit noch deutlicher als ein Aspekt seiner selbst zu erkennen.
Unter dem Einfluss eines Rauschmittels und nachdem er in einem befreienden Lachen den Steppenwolf in sich niedergerungen hat, erfährt er in Pablos „Magischem Theater“ in entfesselten Traumbildern seine innere Vielgestaltigkeit. Er begibt sich auf eine Reise ins Unbewusste, in seine Innenwelt. In der Art von allerlei Jahrmarktzauber erlebt er Szenen wie „Auf zum fröhlichen Jagen. Hochjagd auf Automobile!“ oder „Alle Mädchen sind dein“. Doch anstatt sich dem Vorbeifluten der Bilder und den sich einstellenden Assoziationen hinzugeben und sie „als Schule des Humors“ zu nehmen, will er um jeden Preis Hermine erobern, die er immer mehr als sein „anderes Ich“ erkennt, als den ihm fehlenden Teil. MOZART, als einer der „Unsterblichen“, taucht auf und will ihn davon abbringen, doch Harry halluziniert Pablo und Hermine beim Beischlaf und tötet Hermine und damit gleichsam sein anderes Ich, sein Spiegelbild. Wieder erscheint MOZART und hält ihm einen Vortrag, in dem er auf verblüffend simple Art ein Lebensrezept gibt:
„Sie sollen leben, und sie sollen das Lachen lernen. Sie sollen die verfluchte Radiomusik des Lebens anhören lernen, sollen den Geist hinter ihr verehren, sollen über den Klimbim in ihr lachen lernen. Fertig, mehr wird nicht von ihnen verlangt.“ (S. 192)
So lernt Haller zu begreifen, dass die „Unsterblichen“ heitere Naturen sind, dass Pablo ihm eben das auf unscheinbare Weise vorlebt. Er erfährt, dass heitere Gelassenheit hilft, den unlösbaren Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit in ein spielerisches Ausleben mannigfaltiger Anlagen der Persönlichkeit aufzuheben. Und so endet der Roman mit der Hoffnung auf das Ende der Leiden Harry Hallers, ohne ihn jedoch aus seiner Krise befreit zu haben.
„Einmal würde ich das Figurenspiel besser spielen. Einmal würde ich das Lachen lernen. Pablo wartete auf mich. Mozart wartete auf mich.“ (S. 194)
Stand: 2010
Dieser Text befindet sich in redaktioneller Bearbeitung.
Rechtliches
Ein Angebot von