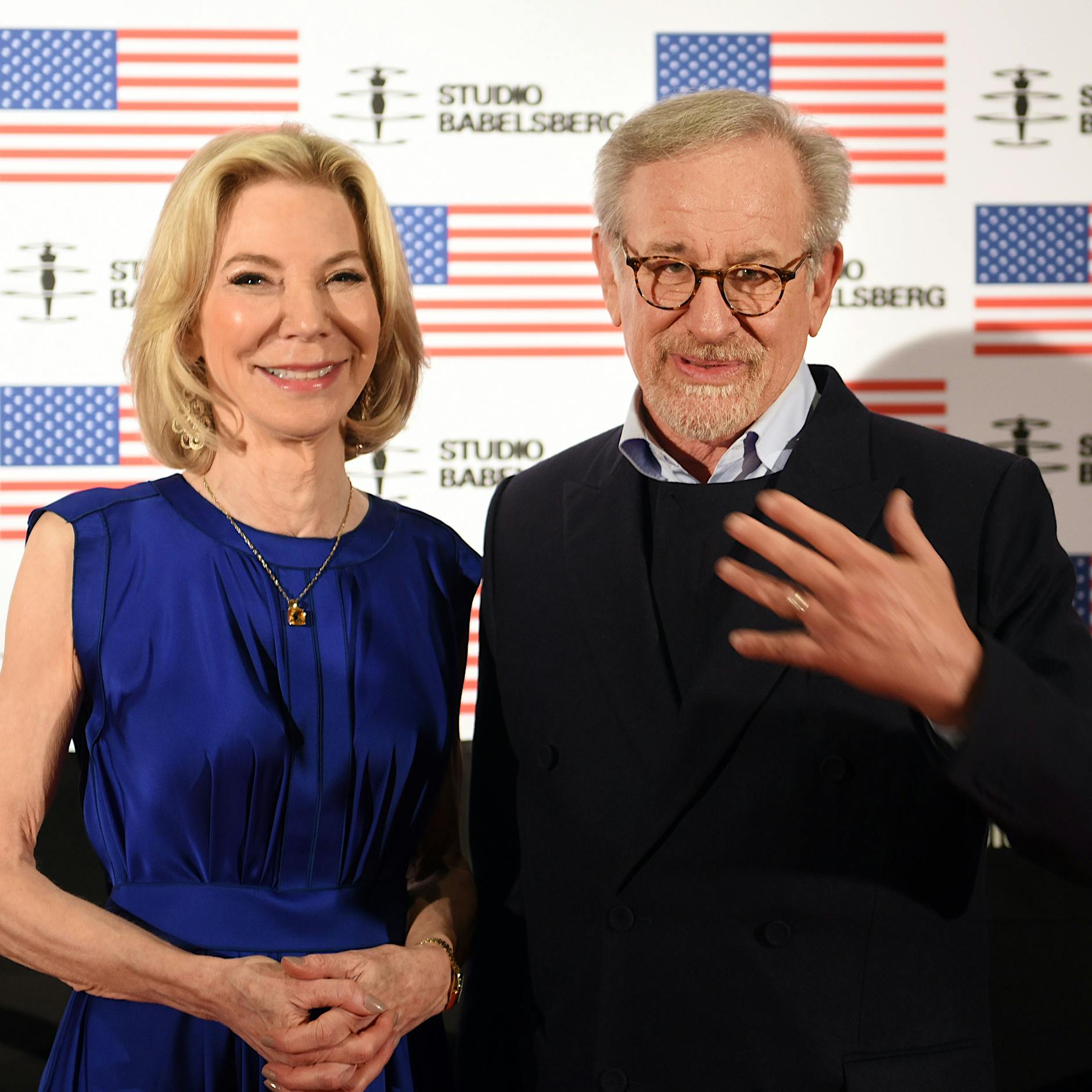Als die neue Außenministerin Annalena Baerbock ihre ersten Reden auf Englisch hielt, erntete sie wegen ihres deutschen Akzents viel Spott im Netz. Ältere Zeitgenossen fühlten sich an einen anderen Außenminister erinnert, der es mit dem gleichen Akzent zu Weltruhm gebracht hat: Henry Kissinger, der als Chef des Außenamtes in Washington in den 1970er-Jahren wichtigster Außenpolitiker der westlichen Welt war.
Nun wird er am 27. Mai 100 Jahre alt, und noch immer wird seine Stimme gehört, wenn er sich zu aktuellen Fragen der Weltpolitik äußert, wie jetzt zum Ukraine-Krieg. Gerade erst hat er in einem Interview dafür plädiert, die Ukraine schnell in die Nato aufzunehmen, was ein interessanter Sinneswandel gegenüber früher von ihm vertretenen Positionen ist.
Sein lebenslang gepflegter deutscher Akzent rührt aus seinen Kindheitstagen im fränkischen Fürth, wo er 1923 als Sohn jüdischer Eltern geboren wurde. Im Sommer 1938, wenige Wochen vor der Pogromnacht, gelang der Familie mit ihren zwei Kindern die Ausreise in die USA. Elf zurückgebliebene Verwandte wurden von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet.
Kissinger ging mit seinem jüngeren Bruder in New York zur Schule, und aus seinem Vornamen Heinz wurde Henry. Sechs Jahre nach der Flucht seiner Familie kam dieser Henry Kissinger wieder nach Deutschland: nun als Soldat der US-Armee, der unter anderem in der Ardennenschlacht kämpfte. Nach der deutschen Kapitulation wurde er wegen seiner Sprachkenntnisse in den Militärgeheimdienst versetzt, der untergetauchte Nazis aufspüren sollte.
Meistgelesene Artikel
Kissinger und die internationale Politik der Vereinigten Staaten
Er blieb bis 1947 in Deutschland, als er ein Stipendium zum Studium der Politikwissenschaften in Harvard erhielt. Kissinger war der Eliteuniversität nach seinem Abschluss für mehr als 20 Jahre als Lehrender und Forschender treu, unter anderem als Leiter des Zentrums für internationale Angelegenheiten und des Programms für Verteidigungsstudien.
Er wurde bald ein viel gefragter Berater der Regierung in Washington, vor allem nach der Veröffentlichung seiner Analyse über „Atomwaffen und Außenpolitik“ 1957, einem Standardwerk zur Politik des atomaren Gleichgewichts des Schreckens, mit der die USA und die Sowjetunion für Jahrzehnte die Weltpolitik beherrscht und stabilisiert haben. Die Präsidenten John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson aus der Demokratischen Partei sowie der Republikaner Richard Nixon schätzten gleichermaßen seinen Rat.
Nachdem Nixon ihn 1969 zum Sicherheitsberater und 1973 zusätzlich zum Außenminister berufen hatte, bestimmte Henry Kissinger für fast zehn Jahre als aktiver Staatsmann die internationale Politik der Vereinigten Staaten. Er wurde in dieser Zeit zu einem der am meisten bewunderten, aber auch am meist gehassten Politiker seiner Generation.
Er galt als eine Art Personifizierung von „Realpolitik“. Sie folgt nicht moralischen Grundsätzen oder politischen Werten, sondern allein den jeweils gerade aktuellen Interessen des eigenen Landes. Das überragende Motiv der Politik Kissingers war, den weltweiten Einfluss der Sowjetunion und die Verbreitung der Ideen des Kommunismus so stark wie möglich zu begrenzen.
In der Systemkonkurrenz zwischen West und Ost schienen die USA in jenen Jahren an Boden zu verlieren. Die Amerikaner litten unter den anhaltenden Misserfolgen im Vietnamkrieg, der zu Hause auf immer mehr Widerstand stieß. Gleichzeitig bremste die erste Ölkrise das Wachstum, während die Sowjetunion ihren Einfluss in Afrika und im Nahen Osten ausbauen konnte. Dagegen mussten die USA nach Überzeugung Kissingers etwas unternehmen.
Während die Einflusszonen der beiden Supermächte in Europa mithilfe ihrer Militärbündnisse Nato und Warschauer Pakt klar geregelt waren, führten sie in Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas Stellvertreterkriege. Kissinger hatte keinerlei Scheu, dort den USA verpflichtete Militärdiktaturen zu installieren oder zu stützen. Das ging bis zum Putsch gegen demokratische Regierungen wie in Chile 1973. Inzwischen veröffentlichte Dokumente der US-Regierung belegen, dass Nixon und sein Sicherheitsberater Kissinger aktiv an den Plänen zum Sturz und zur Ermordung des linken Präsidenten Salvador Allende durch rechte Militärs beteiligt waren.
Kissinger hat in jenen Jahren keinen Hehl aus seiner Verachtung für die Demokratie gemacht, sobald sie für die USA ungünstige Ergebnisse zeitigte. Er könne keinen Grund erkennen, warum man einem bestimmten Land erlauben sollte, „kommunistisch zu werden, nur weil dessen Bevölkerung so unvernünftig ist“, zitierte ihn der Pulitzer-Preisträger Christopher Hitchens in seiner kritischen Biografie „Die Akte Kissinger“. Das betreffende Land war Chile. Kissinger hatte offenbar keinerlei Skrupel, bei solchen Gelegenheiten mit eben solchen rechtsradikalen Kräften gemeinsame Sache zu machen, die seine Familie in Deutschland einst verfolgt hatten.
Doch sein profunder Antikommunismus hinderte Kissinger auch nicht, gleichzeitig Fühler zu den kommunistischen Machthabern in China auszustrecken und erste Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion zu führen. 1971 unternahm er zwei zunächst geheim gehaltene Reisen nach Peking, um ein Treffen Nixons mit dem Partei- und Staatschef Mao Zedong und Premierminister Zhou Enlai vorzubereiten, das im Februar 1972 in Peking stattfand.
Schon seit 1970 führte er in Paris Geheimverhandlungen mit dem nordvietnamesischen KP-Führer Le Duc Tho über einen Friedensvertrag zur Beendigung des Vietnamkrieges. 1973 erzielten beide ein erstes Waffenstillstandsabkommen. Für ihre Bemühungen verlieh ihnen das Nobelpreiskomitee gemeinsam den Friedensnobelpreis, den am Ende aber keiner der beiden akzeptierte.
Der Vietnamese lehnte die Annahme mit der Begründung ab, dass in seinem Land trotz Abzugs der US-Truppen noch immer kein Frieden herrschte. Kissinger gab den Preis 1975 zurück, als die Nordvietnamesen entgegen den Vereinbarungen ganz Südvietnam okkupierten und die Hauptstadt Saigon eroberten. Damit erst war der Krieg wirklich zu Ende, und die USA hatten die erste militärische Niederlage ihrer Geschichte erlitten – gegen einen „viertklassigen Feind“, wie Kissinger notierte.
In den Jahren 1973/74 wandte der Außenminister seine Aufmerksamkeit dem Nahost-Konflikt zu und schuf mit einer intensiven Pendeldiplomatie vor allem zwischen Israel und Ägypten direkte Kontakte zwischen den Konfliktparteien. Er gilt als einer der Wegbereiter der sogenannten Roadmap, mit der sich Palästinenser und Israelis grundsätzlich auf eine Zwei-Staaten-Lösung, also das friedliche Nebeneinander Israels mit einem unabhängigen palästinensischen Staat, verständigt haben.
Für diese Bemühungen nutzte er auch Kontakte der Bundesregierung zu beiden Seiten. Aus dieser Zeit rührte die lebenslange Freundschaft zwischen Kissinger und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Als Schmidt im November 2015 starb, reiste der 92 Jahre alte Henry Kissinger aus New York nach Hamburg und hielt die Trauerrede. Er fand in der Hauptkirche Sankt Michaelis die persönlichsten Worte für den Freund: „Er war ein Pfeiler meines Lebens.“
Mit der Amtsübernahme Jimmy Carters als US-Präsident 1977 zog Kissinger sich aus der aktiven Politik zurück. Carter vertrat eine betont werteorientierte Außenpolitik. Nach dem Desaster des Vietnamkrieges stellte er das Engagement für die Menschenrechte in den Mittelpunkt, um den USA eine neue Legitimationsbasis für ihr weltweites Auftreten zu verschaffen. Das war das Gegenteil der oft zynischen imperialen Politik, die Kissinger verfolgt hatte.
Der gründete in New York sein international tätiges Beratungsunternehmen Kissinger Associates, trat als viel gefragter Redner, Buch- und Kolumnenautor auf, was ihn über die Jahre zum Multimillionär machte. Spätere Präsidenten suchten dann auch wieder seinen Rat, darunter Ronald Reagan und George W. Bush.
Gleichzeitig aber gab es immer wieder Versuche, Henry Kissinger wegen seiner Rolle beim Putsch in Chile und anderen Machenschaften in lateinamerikanischen Staaten juristisch zur Verantwortung zu ziehen und ihn als Kriegsverbrecher anzuklagen. Doch dazu ist es nie gekommen. Entsprechende Vorladungen ignorierte er – ohne Konsequenzen.
Für viele deutsche Politiker gehört es seit Jahrzehnten zum guten Ton, bei Besuchen in den USA auch ein Treffen mit Kissinger zu verabreden. Auf der anderen Seite pflegt er intensive Kontakte nach Deutschland, vor allem zu seiner Geburtsstadt Fürth, deren Ehrenbürger er seit 1998 ist. Seit seiner Kindheit fühlt er sich dem Fußballklub Spielvereinigung Fürth eng verbunden und verfolgt regelmäßig dessen Auf und Ab in den Bundesligen. Vor den Zeiten des Internets ließ er sich montags per Fax und Telefon von der deutschen Botschaft in Washington über die Spielergebnisse vom Wochenende informieren.
Wie populär Henry Kissinger in deutschen Regierungskreisen bis ins hohe Alter geblieben ist, zeigte 2013 die Entscheidung der damaligen Minister Guido Westerwelle (Außen, FDP) und Thomas de Maizière (Verteidigung, CDU), zu seinem 90. Geburtstag eine Stiftungsprofessur unter seinem Namen an der Bonner Universität einzurichten. Damit wollten sie sicherstellen, „dass die außerordentlichen Leistungen Henry Kissingers auf den Gebieten der Diplomatie, Strategie und der transatlantischen internationalen Beziehungen die sicherheits- und verteidigungspolitische Debatte dauerhaft beflügeln“.
Der Plan stieß auf vehementen öffentlichen Widerstand der Grünen und der Linken in Bonn, die auf diverse völkerrechtswidrige Aktivitäten Kissingers während seiner Amtszeit in der Washingtoner Regierung verwiesen. Ihrem Protest schlossen sich 100 Wissenschaftler an, darunter Alfred Grosser und Oskar Negt. Gleichwohl wurde die Professur eingerichtet und mit dem ehemaligen US-Diplomaten James D. Bindenagel besetzt. Als 2019 die Förderung durch die Ministerien auslief, übernahm die Universität Bonn die Professur als regulären Lehrstuhl.
Und nun ist er, der von manchen als eine Art Doyen der internationalen Politik gesehen wird, zurück in der aktuellen Debatte. Wie kann der Krieg gegen die Ukraine beendet werden, das ist natürlich ein Thema für einen Mann seiner Erfahrungen bei der Lösung internationaler Krisen.
Ganz in seiner Denktradition als Realpolitiker hält er sich nicht lange mit moralischen Fragen nach Schuld und Sühne auf. Nach seiner Erwartung wird Russland am Ende viele der besetzten Gebiete in der Ukraine wieder aufgeben müssen, die Krim aber behalten können. Das werde Unzufriedenheit auf beiden Seiten zurücklassen.
Gleichzeitig habe der Westen die Ukraine „jetzt so weit aufgerüstet, dass sie das am besten bewaffnete Land mit der strategisch am wenigsten erfahrenen Führung in Europa sein wird“, sagte er der britischen Zeitschrift Economist. Deshalb sei es für die Sicherheit Europas „besser, die Ukraine in der Nato zu haben, wo sie keine nationalen Entscheidungen über territoriale Ansprüche treffen kann“. Es sei „wahnsinnig gefährlich“, sie sich selbst zu überlassen. Sogar Russland würde profitieren: „Ich würde Putin sagen, dass auch er sicherer ist, wenn die Ukraine in der Nato ist.“
Im Jahr 2014, nach der Annexion der Krim durch Russland, hatte er den Westen noch davor gewarnt, die Ukraine als westliches Bollwerk gegen Russland zu verstehen und um Verständnis für Wladimir Putins Haltung geworben. „Wenn die Ukraine überleben und gedeihen soll, darf sie nicht der Vorposten der einen Seite gegen die andere sein – sie sollte als Brücke zwischen beiden Seiten fungieren.“ Aber das war vor dem Angriffskrieg Russlands gegen das Nachbarland. Noch einmal blitzt hier das strategische Denken des Altmeisters der Geopolitik auf, der früher vertretene Auffassungen schnell verlässt, wenn sich die Kräfteverhältnisse ändern. Und das war in seinem hundertjährigen Leben häufig der Fall.