Technik kurz erklärt Die Entwicklung der Achterbahn
Anbieter zum Thema
In unserer Serie „Technik kurz erklärt“ stellen wir regelmäßig Meisterwerke der Konstruktion und besondere Entwicklungen vor. Heute: die Achterbahn.

Adrenalin, Nervenkitzel, unvergessliche Momente der Schwerelosigkeit – Achterbahnen sind seit langem nicht mehr aus den Freizeitparks wegzudenken und für viele ein großer Spaß. Am 16. August wird der Tag der Achterbahn begangen und wir zeigen, wie es zur Entwicklung kam, wie sich die Achterbahn im Laufe der Zeit verändert hat und stellen die zehn schnellsten Achterbahnen der Welt vor.
Von „Russischen Bergen“ zur Berg-und Talbahn
- Die Vorläufer der Achterbahn kamen aus Russland. Dort baute man im 17. Jahrhundert im Winter hohe Holzgerüste und wässerte sie, damit sie zu Rutschbahnen wurden. Diese künstlichen Rutschhügel waren ein Vergnügen für die Oberschicht und wurden „Russische Berge“ genannt.
- Die „Russischen Berge“ wurden bald auch in Europa populär, besonders in Frankreich. So wurden die Rutschschlitten mit Rädern ausgestattet, um sie ganzjährig nutzen zu können. Um 1812 soll in Paris „Les Montagnes Russes à Belleville“ gebaut worden sein, die vielleicht erste Achterbahn der Welt. Später kam noch die „Promenades Aériennes“ im Jardin Beaujon dazu, die mit Räderwagen und festen Spurschienen ausgestattet war.
- 1869 hatten Constantine de Bodosco und Pedro de Rivera aus Russland bzw. Spanien ihren „Artifical sliding hill“ in den USA schützen lassen. Diese Rutschbahn nimmt direkten Bezug auf die „Russischen Berge“.
- In Pennsylvania wurde 1827 die Mauch Chunk Switchback Railway gebaut. Abgebaute Kohle sollte damals schnell und günstig zum Hafen transportiert werden, deshalb wurde eine steile Bahnstrecke mit natürlichem Gefälle erbaut. Aber nicht nur Kohle wurde transportiert, die Arbeiter machten sich einen Spaß daraus in den leeren Wagen die Berge herunter zu sausen. Nach ein paar Jahren durften erstmals Passagiere mitfahren. Die 14 Kilometer lange Fahrt wurde schließlich eine beliebte Touristenattraktion. Im Jahr 1870 wurde die Kohlebeförderung komplett eingestellt und zwar zugunsten der Touristen, welche dann ihr Vergnügen dort fanden.
- Die schwerkraftgetriebene Bahn aus Pennsylvania inspirierte LaMarcus Thompson zu seiner „Switchback Railway“, die er 1884 baute, und begründete seinen Aufstieg zum „Vater der Achterbahnen“. 1885 erhielt er eines der ersten Achterbahn-Schutzrechtsdokumente für seine „Roller coasting structure“. Er gründete die „L. A. Thompson Scenic Railway Company“, meldete etliche weitere Patente an und baute zahlreiche, immer größere und spannendere „Coaster“. Die Geschwindigkeiten waren eher gering, dafür waren die Bahnen mit üppiger künstlicher Szenerie dekoriert und mit Lichteffekten ausgestattet. Auch in Europa baute Thompson seine Bahnen, von denen einige noch erhalten sind, etwa im Tivoli in Kopenhagen oder im englischen Blackpool.
Mehr Geschwindigkeit und mehr Sicherheit
Die Geschwindigkeiten der Bahnen waren den Menschen aber irgendwann nicht mehr spannend genug, sodass in Amerika die ersten „Figure-8-Bahnen“ gebaut wurden, von denen sich der Begriff Achterbahn ableitet – die Führung der Strecke war wie eine 8 ausgelegt. 1898 wurde die erste moderne Figure-8-Bahn auf Coney Island in New York erbaut.
Im Lauf der Jahre entwickelten sich unterschiedliche Typen von Achterbahnen, etwa „Flying“, „Inverted“, „Dive“ oder „Stand-up“. Neue Patente trieben den Stand der Technik stetig voran. Eines der einflussreichsten meldete John A. Miller 1919 an: Hinter dem Titel „Pleasure railway structure“ verbirgt sich die grundlegende Technik des „underfriction wheel“, also ein zusätzliches Rad unter der Führungsschiene, das ein Entgleisen unmöglich macht und somit die Sicherheit entscheidend verbessert. Es erlaubte auch wesentlich höhere Geschwindigkeiten und eine ausgefallenere Streckenführung. Bis heute werden praktisch alle Achterbahnen nach diesem Prinzip gebaut.
Die erste Achterbahn in Deutschland
1908 wurde in Deutschland das amerikanische Konzept zum ersten Mal in der „Ausstellung München“ unter dem Namen „Riesen-Auto-Luftbahn“ vorgestellt. Die Konstruktionen waren stationär, der Aufbau war sehr aufwendig und erforderte viel Mühe von Zimmerleuten. Nur ein Jahr später wurde das Problem gelöst und die erste transportable Holzachterbahn wurde auf der „Oktoberwiesen“ eingeweiht. 1964 baute Anton Schwarzkopf, der sich schon früher mit der Produktion von Achterbahnen befasste, die erste Stahlachterbahn.
Wie spektakuläre Loopings möglich wurden
Schon 1846 waren die Berg-und Talstrecken bereits mit Kurven ausgestattet und schließlich versuchten sich die Konstrukteure am Bau eines Loopings. Die ersten Loopings waren aber schnell wieder verboten nach der Inbetriebnahme, da sie als viel zu gefährlich galten. Erst durch die Einführung einer elliptischen Kreisbahn und vor allem dank der Entwicklung des Klothoiden-Loopings durch den Münchner Ingenieur Werner Stengel wurden die Überschläge sicher. Mithilfe mathematischer Formeln und Technik schaffte Stengel es, gefahrenfreie Loopings zu konstruieren. Seine Erfindung wurde 1975 in den USA umgesetzt, genauer gesagt beim Modell „Looping Racer“ im kalifornischen Park Six Flags Magic Mountain. 1978 war es dann auch in Deutschland so weit, der „Looping Star“ feierte deutsche Achterbahn-Premiere. Innerhalb weniger Jahre kreierte Werner Stengel eine Achterbahn nach der anderen und so zählt er zu den wichtigsten Achterbahn-Ingenieuren der letzten Jahrzehnte.
Die Technik der Achterbahn
Eine klassische Achterbahnfahrt beginnt damit, dass der Wagen mithilfe eines Kettenantriebs auf die erste Anhöhe, den Lifthügel, gezogen wird. Ab dann setzt er seine Fahrt selbständig fort. Die Energie, die der Wagen allein aufgrund seiner Höhe über dem Erdboden hat, muss für die gesamte Fahrt reichen. Auf dem Lifthügel ist die Energie noch gering, das ändert sich aber schlagartig, wenn der Wagen die erste Abfahrt erreicht. Während er dem Erdboden entgegen rast, wandelt sich seine potenzielle Energie in kinetische Energie um – der Wagen verliert an Höhe, nimmt dafür aber an Geschwindigkeit zu. Im Tal ist die kinetische Energie am größten und die potenzielle Energie am geringsten. Danach fährt der Wagen den nächsten Hügel hinauf und die Energieform wandelt sich von kinetischer wieder zu potenzieller um.
Dieses Spiel der Umwandlung geht die ganze Achterbahnfahrt so weiter, wobei die Summe der beiden Energien immer konstant bleibt. Wenn nicht ein Teil der anfänglichen Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt werden würde, könnte die Achterbahnfahrt bis in alle Ewigkeit andauern.
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/73/76/73761630d91174e956a7f9c54ed954e3/0109180242.jpeg)
Kreativitätstechnik
Mit der SIT-Methode realisierbare Ideen generieren
Wie der initiale Antrieb funktioniert
Der wichtigste Teil einer Achterbahn ist ihr Antrieb, der die Züge auf die erste Anhöhe bringt. Sobald dieses erste Ziel erreicht ist, setzt die Bahn ihre Fahrt selbstständig fort. Dafür sind verschiedene Antriebstechniken im Einsatz:
- Der Klassiker unter den Antriebsarten ist das Hügellift-Prinzip: Der Zug wird zu Beginn meist mit einer Gliederkette einen Anstieg hinaufgezogen. Eine Rückrollsicherung sorgt dafür, dass der Zug im Störungsfall nicht unkontrolliert rückwärts rollt.
Etwas ausgefallener ist der Trommellift, bei dem sich der Zug in einer Spirale nach oben schlängelt. In der Mitte liegt eine rotierende Achse, welche über einen Mitnehmer den Zug bewegt.
- Der Katapultstart: Bei einer Katapult-Achterbahn wird der Zug nicht auf einen Hügel befördert, sondern katapultartig durch ein elektrisches Traktionssystem beschleunigt. Meist erfolgt dies anhand eines Mitnehmers, der an einem Stahlseil befestigt ist, das den Zug beschleunigt. Der Achterbahnwagen kann fast aus dem Stand auf waagerechter Strecke beschleunigt werden. Dafür gibt es verschiedene Antriebskonzepte: Hydraulische Lösungen, die verhältnismäßig günstige Reibradlösung oder die Beschleunigung über elektromagnetische Felder (LSM-Launch).
- Daneben gibt es durch Elektromotoren im Zug angetriebene Achterbahnen (Powered Coaster)
Wie bremsen Achterbahnen?
Die Achterbahnzüge sind meist sehr schwer und erreichen hohe Geschwindigkeiten. Bei Bremsen, die nach dem Reibungsprinzip funktionieren, ist unter diesen Voraussetzungen ein extrem hoher Verschleiß zu erwarten. Deshalb kommen bei Achterbahnen in der Regel berührungslose Bremstechniken mit elektromagnetischer Induktion zum Einsatz, die auch bei Stromausfall funktioniert.
Die meisten Achterbahnen verwenden Wirbelstrombremsen, wobei an der Schiene Magnete und am Zug Kupferbleche befestigt werden. Sobald die Kupferbleche in den Magnetbereich gelangen, entstehen Wirbelströme, die ein entgegengesetztes Magnetfeld erzeugen und den Zug rasch abbremsen. Auf der Wegstrecke und auch am Ende der Achterbahn kommen häufig zusätzlich klassische Reibungsbremsen zur Anwendung, um die Geschwindigkeit zu regulieren beziehungsweise den Zug komplett zu stoppen.
Quellen:www.weltderphysik.de, www.dpma.de
(ID:49630861)



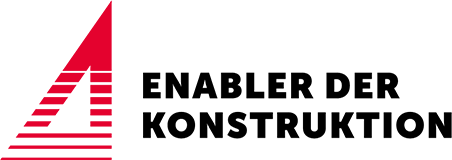
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cc/5f/cc5fa7cbbf73fae38599439806635fb2/0118089710v4.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/0c/10/0c10a78d1c2a20578d0abb96c889ecd0/0118704053v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/10/d3/10d3d30719168685eadda6ff8406a6f8/0116907039v1.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/92/6a/926afc8ecc3f1990f4df20dde2eb586e/0118500346.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/64/1e/641e6b14fa71c3b6ef5b8a6e4de4161b/0118354681.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/05/38/053858c8478deed90248fb476e3b618d/0118546708.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/49/9f/499f650a5af5f751a7331bf31404a03a/0118740904v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/12/43/12430acfc5da9318a4509ff171cf3b92/0118677512v3.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/25/56/2556135ec577c26cb4112726f79057ee/0118743991v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/41/10/4110624f2f307a5847d6bb9587cfb1dc/0118612628.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/e1/b6e1def1737103251b629a7af8353dca/0117791878.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4c/50/4c50752a1a0149d628c57f9aa30ddf14/0118161790.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8c/71/8c717a65b40a37587b6da542be6aca46/0118039147.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7d/ab/7dab4d895f66794711342f1898a073b9/0118325242.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/88/d78882b9b0021964aa9b8a897d2a227d/0116207963.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2d/cc/2dccdd932dcae7166c9361f6ae51a71a/0115772606.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/e6/d9e690bafb2009db4c75af2c5ea5643a/0115496060.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f9/6a/f96a33b9beeb8579c4e701904847bb42/0117986803.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/85/14/851490e4dc41e61f568161a5bb4477cb/0117114094.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b6/7b/b67b1b6e75932292d7467d447aa5c7c0/0116800090.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/64/fe/64fec73b1a2fb/logo-master-ggbbytimken-286blue.jpeg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/5e/85/5e85fa8f0f18b/smc-pantone-285.jpg)
:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/65/08/65081bf8d1e1c/logo-kisssoft-claim-below-en-v00-cs-public.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f8/b1/f8b1b1e8db6b76b3022e821dd82411b8/0113095782.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/45/3c/453c102927440126be74b1f71cea036a/0113094047.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/78/e9/78e9ba5153515a04a4d994adb6f81770/0113106726.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/01/9b/019bc1d25eb4847c4875bb4fcced18e6/0113094052.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/34/55/3455ee280dc37ac768c3766f3d822663/0118664328v2.jpeg)
:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/db/f9/dbf9b81a1833c9195434d3376d5fdd1a/0116165013.jpeg)