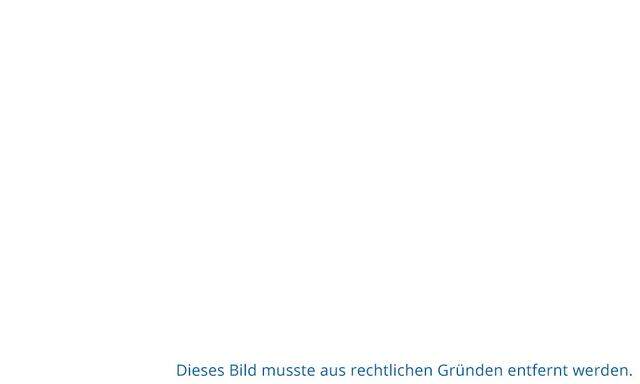Der Erste Weltkrieg läutet den Untergang europäischer Herrscherhäuser ein: Die Habsburger, Hohenzollern und Romanows verlieren ihre Krone.
Zar Nikolaus II. schreibt: „Von der Bahn griff der Streik in die Fabriken und Werkstätten und dann sogar auf die Einrichtungen der Stadtverwaltung über und schließlich auf das Eisenbahndepartement des Ministeriums selbst. Welche Schmach.“ Es ist das Jahr 1905. Wie ein Riss in einer Eislandschaft verbreiten sich die Unruhen im riesigen Russland, während der Zar entsetzt diesen Brief an seine Mutter verfasst. Neun Jahre sind seit seiner Krönung vergangen, und nur halbherzig gibt er den Rufen nach und lässt ein Parlament (Duma) errichten, das kurze Zeit später grandios scheitern wird. Sergei Juljewitsch Witte, Politiker, Unternehmer und Architekt der ersten Duma, muss mitten in den politischen Wirren zurücktreten. Er resümiert: „Ganz Russland ist ein einziges riesiges Irrenhaus.“
Nikolaus II. wird der letzte Zar sein. Das Reich der Romanows wird mit Ende des Ersten Weltkrieges untergehen, wie auch die Dynastien der Habsburger, Hohenzollern und auch der Osmanen. Nikolaus ist ein glückloser Herrscher, ein wankelmütiger Mann, politisch überfordert, reformresistent. Als bei seiner Krönung (1896) Bier und Essen ausgeschenkt wird, finden sich eine halbe Million Menschen ein, von denen Hunderte nach einem Panikausbruch zu Tode zertrampelt werden. Am selben Abend wird der Zar eine Balleinladung der französischen Botschaft annehmen, diese Geste werden ihm viele nicht verzeihen. Der verlorene Krieg gegen Japan (1904/05) wird den Riss zwischen Zar und Volk vertiefen. Als im Jahr 1905 in St. Petersburg 200.000 Menschen dem Zaren eine Petition übergeben wollen, schießen Soldaten in die friedliche Menge. Nicht zuletzt dieser „Blutige Sonntag“ wird revolutionäre Umtriebe heraufbeschwören. Viele Revolutionäre werden getötet oder verhaftet, zwei von ihnen werden die Gefangenschaft überleben: Wladimir Iljitsch Uljanow und Lew Dawidowitsch Bronstein, besser bekannt als Lenin und Trotzki – in den Händen des Ersteren wird die Zukunft des Landes liegen.
Noch bevor die Oktoberrevolution 1917 losdonnert, dankt der Zar zugunsten seines Bruders Michail ab. Auch er wird später ermordet werden, wie Nikolaus und seine Familie. Der Zar ist mit Alix von Hessen-Darmstadt verheiratet, eine Liebesheirat, sie haben vier Töchter und den kränkelnden Sohn Alexei. Die Familie wird nach der Abdankung Nikolaus' unter Hausarrest gestellt, ehe sie nach Sibirien verbannt und später nach Jekaterinburg verlegt wird. Es ist Juli 1918, als Jakow Michailowitsch Jurowski, führender Bolschewik der Ural-Region, notiert, dass ein Telegramm angekommen sei, „beinhaltend die Anordnung, die Romanows zu liquidieren“. Gegen zwei Uhr früh wird die Familie aufgeweckt und in den Keller des Ipatjew-Hauses, wo sie gefangen gehalten werden, geführt. Dort stirbt die Familie im Kugelhagel, später werden die Leichen in ein Waldstück gebracht, verbrannt und vergraben.
Vermeintliche Überlebende. Es hält sich die Legende, dass eine Zarentochter den Mord überlebt habe. Tatsächlich fehlen bei der Exhumierung der Knochen in den 1990er-Jahren zwei Leichen, von Alexei und seiner Schwester Maria. Erst nach mehreren Jahren werden auch ihre Knochen entdeckt.
Mit seinem Cousin Wilhelm II., der in Berlin auf dem Thron sitzt, hat der Zar eine merkwürdige Beziehung. In ihren Briefen nennen sie einander Willy und Nicky, aber zwischen den Zeilen spricht auch Missgunst: Wilhelm animiert Nikolaus zu der verheerenden kriegerischen Auseinandersetzung mit Japan (nicht zuletzt, um ihn von Europa abzulenken).
Wilhelm II. ist seit 1888 Herrscher der Hohenzollern. Er ist selbstbewusst, bisweilen egozentrisch und größenwahnsinnig. Zu Ende des 19. Jahrhunderts umfasst der Berliner Hof 3500 Personen und frisst 20 Prozent des Haushaltes. Nicht nur deswegen leidet das Image des Hauses: Die Presse weidet genüsslich Informationen über Sexorgien und Exzesse in adeligen Kreisen aus, die durch intime Briefe an die Öffentlichkeit gelangen.
Mit der Herrschaft Wilhelms endet auch die Ära Otto von Bismarcks, der eisern die Geschicke Preußens geleitet hat. Was Bismarck immer zu vermeiden suchte, wird mit Wilhelm Realität: eine französisch-russische Allianz (nach der Gründung der Triple Entente liegt Preußen eingekeilt zwischen Frankreich, Russland und dem Vereinigen Königreich im Norden, das hier die See kontrolliert) sowie Krieg an mehreren Fronten.
Hinzu kommt, dass es auch innerhalb der Arbeiterschaft in Deutschland gärt. Während ein charismatischer August Bebel die Arbeiter sozialdemokratisch organisiert, werben die Spartakisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht für eine Räterepublik nach bolschewistischem Vorbild. Als Luxemburg und Liebknecht schreiben: „Wir müssen die Dynastien beseitigen“, tragen sie bereits Eulen nach Athen. Es ist das letzte Kriegsjahr. Als in Kiel ein hoffnungsloser Einsatz gegen England vorbereitet werden soll, meutern wütende Matrosen. Mehrere von ihnen werden verhaftet, bei folgenden Aufständen sterben etliche Demonstranten. Es ist der Auftakt einer Unruhewelle, die auf Arbeiter und Soldaten übergeht. Wilhelm weilt im belgischen Spa, als ihm General Wilhelm Groener sagt: „Ihre Majestät hat keine Armee mehr.“ Für den Kaiser soll der Aufstand seiner Matrosen beschämender gewesen sein als die Niederlage gegen den Erbfeind Frankreich. Wilhelm beugt sich dem Druck, will zwar als Deutscher Kaiser abdanken, aber Preußens König bleiben – es gelingt ihm nicht. Er kann mit einer kleinen Gefolgschaft und zwei Autos in das holländische Exil gelangen. Die Weimarer Republik geht vergleichsweise milde mit dem alten Herrschergeschlecht um. Dem Ex-Kaiser wird erlaubt, Waggonladungen voll mit seinen Besitztümern in das holländische Exil zu transportieren. Adelstitel sind von nun an Teil des Namens.
Monarchie sackt zusammen. Bei der Krönung des ersten Romanow-Zaren 1613 blicken die Habsburger bereits auf eine über 300-jährige Herrschaftsgeschichte zurück. Ihr Weg in den Untergang ist im Vergleich zu den anderen Dynastien eher ein In-sich-Zusammensacken des Reichs – mit den Schicksalen der Habsburger als melodramatische Begleitmusik. Auf den psychisch labilen Ferdinand I. (genannt „der Gütige“, oder spöttisch: „Gütinand der Fertige“) folgt im Jahr der bürgerlichen Revolution 1848 der achtzehnjährige Franz Joseph I. Fünf Jahre später wird er ein Attentat des ungarischen Schneiders Janos Libényi überleben, sein Motiv – die Befreiung Ungarns – zeigt bereits, was dem Vielvölkerreich noch bevorstehen wird: nationalstaatliche Bestrebungen.
Franz Josephs Bruder Maximilian nimmt die Krone Mexikos an, wird dort allerdings erschossen. Elisabeth (Sisi), die Frau Franz Josephs, wird in Genf vom Anarchisten Luigi Lucheni ermordet. Kronprinz Rudolf und seine Geliebte Mary Vetsera begehen in Mayerling Selbstmord. Der nächste Thronfolger, Franz Ferdinand, wird in Sarajewo ermordet, der Erste Weltkrieg beginnt.
Als Franz Joseph im Kriegsjahr 1916 stirbt, ist er über sechs Jahrzehnte lang Monarch gewesen. Sein Nachfolger Karl I. wird die Kaiserwürde 100 Wochen lang tragen. Einen Monat vor Karls Thronbesteigung im November 1916 erschießt Friedrich Adler, Sohn Victor Adlers, des Begründers der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, den Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh. Adler will damit die Reinstallierung des Parlaments erwirken, das Franz Joseph mit Beginn des Krieges aufgelöst hat. Karl bleibt nicht viel übrig. Sitzt nun der Weimarer Republik der Sozialdemokrat Friedrich Ebert vor, wird in Wien der Sozialdemokrat Karl Renner das Ruder übernehmen.
Das Abdankungsdokument für Karl wird vorbereitet, als der christlich-soziale Politiker Ignaz Seipel nicht ohne Wehmut feststellt: „Wir haben gerade tausend Jahre Habsburg zu Grabe getragen.“ Nachdem Wilhelm II. ins Exil geht, steht fest, dass auch Karl nicht weiter Herrscher bleiben kann. Seine Frau Zita versucht noch vergeblich, ihn von der Unterzeichnung der Abdankung abzuhalten (er unterschreibt schließlich mit Bleistift). Die Familie flieht zunächst in ihr Schloss im Marchfeld und geht später ins ausländische Exil. Karl stirbt 1922 auf Madeira. Über 80 Jahre später wird Österreichs letzter Kaiser seliggesprochen.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2014)