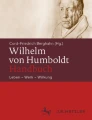Zusammenfassung
Die 1800 erschienene Schrift stellt das Hauptwerk aus der zweiten, der transzendentalphilosophischen Periode des Autors dar und ist zugleich die geschlossenste und umfassendste Explikation des sich zumeist nur in Entwürfen äußernden Schelling'schen Denkens. Obwohl das Werk die Ergebnisse der kritischen Philosophie Kants voraussetzt, stellt das System des transcendentalen Idealismus im Überschreiten des von Kant abgesteckten Erkenntnisbereichs und in engem Anschluss an Fichtes Wissenschaftslehre, die hier durch eine Philosophie der Kunst überhöht wird, einen neuen Versuch spekulativer Metaphysik dar. Schelling untersucht hier nicht allein die Frage, innerhalb welcher Grenzen Erkenntnis überhaupt möglich ist, sondern rückt das entscheidende Charakteristikum allen Wissens, die Übereinstimmung von Subjekt (Geist, Intelligenz) und Objekt (Natur) als ontologische Polarität in den Blickpunkt. Die schon früher formulierte Schelling'sche Naturphilosophie ging von der Natur als dem objektiven Pol aus und führte zu der Feststellung, dass in der menschlichen Vernunft die Natur in sich selbst zurückkehre und identisch sei mit dem, was Intelligenz genannt werde. Dagegen wählt die Transzendentalphilosophie (als Korrelat der Naturphilosophie) den subjektiven Pol – das Selbstbewusstsein – zum Ausgangspunkt, wobei dann zu zeigen ist, wie zum Subjekt als dem Absoluten die Welt der Objekte hinzukommt.
Ursprünglich veröffentlicht unter © J.B. Metzler’sche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst Poeschel Verlag GmbH
Similar content being viewed by others
deutsch
FormalPara HauptgattungSachliteratur
FormalPara UntergattungPhilosophie
Die 1800 erschienene Schrift stellt das Hauptwerk aus der zweiten, der transzendentalphilosophischen Periode des Autors dar und ist zugleich die geschlossenste und umfassendste Explikation des sich zumeist nur in Entwürfen äußernden Schelling'schen Denkens. Obwohl das Werk die Ergebnisse der kritischen Philosophie Kants voraussetzt, stellt das System des transcendentalen Idealismus im Überschreiten des von Kant abgesteckten Erkenntnisbereichs und in engem Anschluss an Fichtes Wissenschaftslehre, die hier durch eine Philosophie der Kunst überhöht wird, einen neuen Versuch spekulativer Metaphysik dar. Schelling untersucht hier nicht allein die Frage, innerhalb welcher Grenzen Erkenntnis überhaupt möglich ist, sondern rückt das entscheidende Charakteristikum allen Wissens, die Übereinstimmung von Subjekt (Geist, Intelligenz) und Objekt (Natur) als ontologische Polarität in den Blickpunkt. Die schon früher formulierte Schelling'sche Naturphilosophie ging von der Natur als dem objektiven Pol aus und führte zu der Feststellung, dass in der menschlichen Vernunft die Natur in sich selbst zurückkehre und identisch sei mit dem, was Intelligenz genannt werde. Dagegen wählt die Transzendentalphilosophie (als Korrelat der Naturphilosophie) den subjektiven Pol – das Selbstbewusstsein – zum Ausgangspunkt, wobei dann zu zeigen ist, wie zum Subjekt als dem Absoluten die Welt der Objekte hinzukommt.
Das Werk ist in drei Teile gegliedert: Der erste Teil ist dem theoretischen Bewusstsein (dem Erkenntnisvorgang) gewidmet, der zweite dem praktischen Bewusstsein – er begründet die Fundamentalbegriffe von Ethik, Recht und Geschichte –, der dritte, abschließende Teil ist eine Philosophie der Kunst. Höchstes Prinzip der Transzendentalphilosophie ist das Selbstbewusstsein, das nach Schelling in vollkommener Freiheit sowohl sich selbst produziert als auch durch „unbewußte Produktion“ die Welt der Objekte hervorbringt. Im Einzelnen durchläuft Schelling zufolge das Selbstbewusstsein in seiner Geschichte mehrere Stadien. Das erste Stadium reicht von der „ursprünglichen Empfindung“ bis zur „produktiven Anschauung“. Auf dieser Stufe erkennt das Subjekt noch nicht, dass die „Anschauung“ von ihm selbst hervorgebracht ist. Dementsprechend erfolgt in diesem Zusammenhang die Deduktion der Materie als des dem Subjekt zunächst am fernsten stehenden Bereichs der Natur. Erst im zweiten Stadium, dem der Reflexion, innerhalb deren zwischen innerer und äußerer Anschauung unterschieden wird, gelangt das Subjekt dazu, sich die eigene Tätigkeit bewusst zu machen, nämlich das Hervorbringen der mit dem Potenzenreich der Natur qualitativ gleichen Formen des Objektbewusstseins (Begriffe, Kategorien). Von zentraler Bedeutung erweist sich dabei für Schelling die Kategorie der Kausalität, in die alle anderen Kategorien, nicht aber Raum und Zeit eingehen. Um zu zeigen, wie das Subjekt durch die Objekte affiziert wird, ist auf dieser Stufe auch die Deduktion des „Organischen“ vorzunehmen. Noch aber steht hier die inhaltliche Struktur der Begriffe und Kategorien im Mittelpunkt, nicht die Art ihres Produziertseins. Der Übergang von der Reflexion zum absoluten Willensakt macht das Wesen der dritten Stufe des theoretischen Bewusstseins aus. Erst auf dieser Stufe richtet sich die Reflexion auf die intellektuelle Anschauung selbst, erst hier erkennt das Subjekt voll und ganz, dass die Welt der Objekte von ihm unbewusst produziert worden ist.
Mit dem absoluten Willensakt ist die Ebene des praktischen Bewusstseins erreicht, das in der praktischen Philosophie behandelt wird und dadurch gekennzeichnet ist, dass an die Stelle der unbewussten Produktion des theoretischen Ichs die mit empirischem Bewusstsein ausgeübte freie Ich-Tätigkeit tritt. Die sich aus den Schelling'schen Prämissen ergebende Willensfreiheit wird allerdings nur negativ als Möglichkeit der Entscheidung gegen das Sittengesetz verstanden. In der Geschichte bilden Freiheit und Notwendigkeit eine Synthese, so dass trotz der Möglichkeit freien Handelns des Einzelnen die Geschichte nach einem sinnhaften Plan abläuft, der sich als das Walten Gottes darstellt. Als Verbindung der theoretischen und der praktischen Philosophie bildet die Philosophie der Kunst die dritte transzendentalphilosophische Teildisziplin, wobei zum ersten Mal seit Diderots Recherches philosophiques sur l'origine et la nature du beau (Philosophische Untersuchungen über den Ursprung und die Natur des Schönen) eine eigentliche Ästhetik entwickelt wird. Sie soll die Identität vom theoretischen und praktischen Ich im Kunstwerk erweisen; dieses vereinigt in sich nicht nur den Charakter der freien Produktion des Geistes, sondern auch die Merkmale der unbewussten Produktion der Natur.
Das System des transcendentalen Idealismus stellt neben Fichtes Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794/95) und Hegels Phänomenologie des Geistes (1807) eine der wichtigsten Stufen in der Entwicklung des Deutschen Idealismus dar. Durch die hier gewonnenen Ergebnisse sollen die Einseitigkeiten der kritischen Reduktionen Kants korrigiert werden, ohne dass auf einen dogmatischen Rationalismus (Spinoza) zurückgegangen wird. Das bei Schelling vielfach zu beobachtende Verfahren bloß analogisierenden Reflektierens – ein Fehler, den vor allem Hegel feststellte – ist im System des transcendentalen Idealismus sehr weit zurückgedrängt. Doch hat sich das erkenntnistheoretische und naturphilosophische Denken des Positivismus und der auf ihn folgenden Systeme meist in der Antithese zu Schelling vollzogen. In der Ethik konnte er sich neben dem Rigorismus Fichtes nicht selbständig behaupten. Am tiefsten wirkte die im System des transcendentalen Idealismus entwickelte Ästhetik. Über den philosophischen Bereich hinaus wurde sie wegen ihrer hohen Bewertung der Kunst und der hier versuchten Synthese von Bewusstem und Unbewusstem für die allgemeine Weltanschauung der Romantik entscheidend.
Bibliographie
Literatur
L. Eley: Fichte, S., Hegel. Operative Denkwege im ‚Deutschen Idealismus‘, 1995.
G. Gamm: Der deutsche Idealismus. Eine Einführung in die Philosophie von Fichte, Hegel und S., 1997.
C. Danz: System als Wirklichkeit. 200 Jahre S.s ‚System des transzendentalen Idealismus‘, 2001.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Section Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 2020 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature
About this entry
Cite this entry
Schäfer, C. (2020). Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: System des transcendentalen Idealismus. In: Arnold, H.L. (eds) Kindlers Literatur Lexikon (KLL). J.B. Metzler, Stuttgart. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_20278-1
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05728-0_20278-1
Received:
Accepted:
Published:
Publisher Name: J.B. Metzler, Stuttgart
Print ISBN: 978-3-476-05728-0
Online ISBN: 978-3-476-05728-0
eBook Packages: Kindlers Literatur Lexikon (KLL)