Zoomposium with Professor Dr. Mark Solms: „Expedition to the sources of consciousness. The feelings as the embodiment of consciousness.“
1. Informationen zur Person und seinen wissenschaftlichen Forschungsarbeiten
Wir hatten diesmal die große Ehre und Freude in einem weiteren sehr spannenden Interview aus unserem Zoomposium-Themenblog „Kognitive Neurowissenschaften und Erkenntnistheorie“ mit dem sehr bekannten südafrikanischen Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Mark Solms zu sprechen, der eine eigene Disziplin, die „Neuropsychoanalyse“ im Sinne Sigmund Freuds weitergeführt und erfolgreich angewendet hat. Er ist „Leiter der Abteilung für Neuropsychologie am Groote Schuur Hospital in Kapstadt sowie seit 2005 Professor für Psychiatrie am Mount Sinai Hospital in New York, sowie Herausgeber und Übersetzer der Complete Neuroscientific Works (Gesammelten Neurowissenschaftlichen Werke) von Sigmund Freud. Solms strebt eine Synthese aus Neurologie und Psychoanalyse an und war Gründungsherausgeber der Zeitschrift Neuro-Psychoanalysis, deren Beirat Hirnforscher wie Antonio Damasio oder Wolf Singer angehören.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Solms)
Marks wisssenschaftliche Arbeit kann als logische Fortsetzung des von Sigmund Freuds angestrebten „empirischen Grundsteinlegung“ für die „Psychoanalyse“, die Freud damals schon angestrebt hatte, aber aufgrund der Ermangelung der technologischen Möglichkeiten (fMRT, EEG, PET) der kognitiven Neurowissenschaften nicht zur Verfügung hatte. Die bahnbrechenden Ergebnisse der bildgebenden Verfahren in den kognitiven Neurowissenschaften nutzt Mark in seiner Forschung, um die Phänomenologie der Psyche (Emotionen und Affekte, Gedächtnis, Schlaf und Traum, Konflikt und Trauma, bewusste und unbewusste Problemlösungsprozesse) mit den empirischen Daten der Physis (neuronale Aktivitäten und Prozesse) zu korrelieren. In der sogenannten „Neuropsychoanalyse“ werden folglich versucht die Methoden der Hirnforschung mit Ideen aus der Psychoanalyse zu verbinden.
Die Ergebnisse seiner wisssenschaftliche Arbeit deuten alle daraufhin, dass wir bei der Aufklärung des großen Rätsels, „der Konstitution von Bewusstsein“, scheinbar seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten an der falschen Stelle suchen, weil wir Bewusstsein immer mit kognitiver (menschlicher) Intelligenz gleichgesetzt und immer nur im Bereich des Cortex verortet haben. In seinem 2022 erschienen populärwissenschaftlichen Buch „The Hidden Spring – A Journey to the Source of Consciousness“ versucht er zurück zu den möglichen „Quellen des Bewusstseins“ zu gelangen, um einen alternativen Lösungsvorschlag für das „hard proplem of consciousness“ anzubieten:
„The hard problem of consciousness is said to be the biggest unsolved puzzle of contemporary neuroscience, if not all science. The solution proposed in this book is a radical departure from conventional approaches. Since the cerebral cortex is the seat of intelligence, almost everybody thinks that it is also the seat of consciousness. I disagree; consciousness is far more primitive than that. It arises from a part of the brain that humans share with fishes. This is the `hidden spring‚ of the title. Consciousness should not be confused with intelligence. It is perfectly possible to feel pain without any reflection as to what the pain is about. Likewise, the urge to eat – a feeling of hunger – need not imply any intellectual comprehension of the exigencies of life. Consciousness in its elemental form, namely raw feeling, is a surprisingly simple function.“ (Mark Solms: The Hidden Spring – A Journey to the Source of Consciousness. p. 7, Hervorhebungen hinzugefügt.)
Na endlich sagt/schreibt es mal einer! 😉 Der von mir schon so oft „gebetsmühlenartig“ geforderte „Paradigmenwechsel“ im „neurozentristischen Weltbild“ setzt sich so langsam aber allmählich durch, da die Mühlen des Wissenschaftsbetriebs nun einmal sehr langsam malen. Daher hatte es mich umso mehr gefreut einen so prominenten Fürsprecher für dieses Interview zu gewinnen. Mark schlägt nämlich in seinem Buch und auch im Interview vor, die Gefühle und Affekte oder auch die Embodied embedded cognition in die Aufklärung des Phänomens Bewusstsein mitaufzunehmen, um die Sackgasse des Neurozentrismus im cerebralen Cortex zu verhindern.
Es ist vielleicht einfach nur unsere anthropozentrische Sichtweise, die uns den Zugang zum Problem versperrt, wenn wir immer von unserem menschlichen Bewusstsein ausgehen und Bewusstsein im Allgemeinen vielleicht eine viel „einfachere Funktion“ ist: „Consciousness in its elemental form, namely raw feeling, is a surprisingly simple function.“, ohne bei diesem Standpunkt direkt zu Panpsychisten werden zu müssen. Im Gegenteil Marks wissenschaftliche Arbeit versucht an die „Quellen des Bewusstseins“ („sources of consciousness„) zurückzugehen, um hier viel allgemeinere Prinzipien der Natur offenzulegen.
Einen ähnlichen Ansatz hat Mark in der Zusammenarbeit mit Karl Friston verfolgt. Friston ist ein sehr renommierter, oft zitierter (h-Index von 253) britischer Neurowissenschaftler am University College London, der sich mit mathematischen Modellen für bildgebende Verfahren in den kognitiven Neurowissenschaften und der Gehirnkartierung beschäftigt hat. Aus diesem „Joint Venture“ ist ein Paper „How and Why Consciousness Arises: Some Considerations from Physics and Physiology“ (2018) entstanden. Hierin und in einem weiteren Artikel „The Hard Problem of Consciousness and the Free Energy Principle“ (2019) versucht er das von Karl Friston entwickelte Konzept des „free energy principle“ für die Lösung des „hard problem of consciousness“ fruchtbar zu machen.
In diesem Zusammenhang geht Mark auch aufgrund der gefundenen wissenschaftlichen Ergebnisse davon aus, dass man das Konzeptes einer „erweiterten Homöostase“ auch auf die die Gefühle/Affekte explizit übertragen kann. Dies wirft natürlich im Zusammenhang mit einem möglicherweise vorhandenen schlüssigen Funktionalismus die Frage auf, ob das „free energy principle“ oder „predictive coding/processing“ auch für eventuelle technologische Möglichkeiten einer „multiplen Realisierung“ in Form des schon oft erwähnten „künstlichen Bewusstseins“ („AC/DC = artificial consciousness/digital consciousness“) auf Maschinen (s. „Zoomposium mit Dr. Patrick Krauß: „Bauanleitung Künstliches Bewusstsein“) nutzbar gemacht werden könnte.
Diese und andere spannende Fragen haben Axel und ich in unserem Interview mit Mark gestellt. Die möglichen Antworten sind in unserem englisch-sprachigen Video auf unserem Youtube-Kanal zu sehen. Um sich aber schon einmal ein Bild machen zu können, seien hier schon einmal die Interviewfragen auf Deutsch vorgestellt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns auf unserer „Expedition to the sources of consciousness“ begleiten würden.
2. Interviewfragen: „The sources of consciousness or why Freud’s emotions are still important – with Prof. Mark Solms“
1. Als Herausgeber und Übersetzer der Complete Neuroscientific Works (Gesammelten Neurowissenschaftlichen Werke) von Sigmund Freud und Gründungsherausgeber der internationalen Zeitschrift „Neuro-Psychoanalysis“ können Sie als Initiator und Mitbegründer einer neuen Forschungsrichtung der „Neuropsychoanalyse“ angesehen werden.
Lassen Sie uns zunächst kurz über die Psychoanalyse sprechen. Sie ist heutzutage vielleicht erklärungsbedürftiger als zu früheren Zeiten, auch wenn ihr Gründer Sigmund Freud immer noch für einen Bestseller gut ist (man denke an „Der Trafikant“ von Robert Seethaler).
Böse Zungen behaupten, die Psychoanalyse sei schon per Konstruktion unwiderlegbar, weil sie Kritik an ihr durch Verdrängung erkläre, wodurch sie selbst wieder bestätigen würde. Dietrich Schwanitz schreibt in seinem Bestseller „Bildung. Alles, was man wissen muß“ über die Psychoanalyse gar: „Sie schaffte selbst die Probleme, als deren Lösung sie sich verkaufte.“
- Wo steht die Psychoanalyse heute und welchen Nutzen können wir aus ihr heute noch ziehen?
Ein weiterer Kritikpunkt an der Psychoanalyse wird in ihrer angeblichen mangelnden empirischen Überprüfbarkeit gesehen. Sigmund Freud hatte selbst schon in seinem Buch „Entwurf einer Psychologie“ (1895/1950) seine Vision beschrieben, dass die Erkenntnisse der Psychoanalyse sich auch mit den Methoden der Naturwissenschaften belegen lassen müssten.
- Sehen Sie dieses Ziel durch die bahnbrechenden Ergebnisse der bildgebenden Verfahren in den kognitiven Neurowissenschaften erreicht oder sind wir immer noch weit davon entfernt die Psyche (Emotionen und Affekte, Gedächtnis, Schlaf und Traum, Konflikt und Trauma, bewusste und unbewusste Problemlösungsprozesse) auf die Physis (neuronale Aktivitäten und Prozesse) zurückführen zu können?
In der „Neuropsychoanalyse“ verbinden Sie nun die Methoden der Hirnforschung mit Ideen aus der Psychoanalyse.
- Wie muss man sich dies vorstellen und was sind Ihre Forschungsziele?
2. In Ihrem Buch „The Hidden Spring – A Journey to the Source of Consciousness“ (2022) versuchen Sie zurück zu den möglichen „Quellen des Bewusstseins“ zu gelangen, um einen alternativen Lösungsvorschlag für das „hard proplem of consciousness“ anzubieten:
„The hard problem of consciousness is said to be the biggest unsolved puzzle of contemporary neuroscience, if not all science. The solution proposed in this book is a radical departure from conventional approaches. Since the cerebral cortex is the seat of intelligence, almost everybody thinks that it is also the seat of consciousness. I disagree; consciousness is far more primitive than that. It arises from a part of the brain that humans share with fishes. This is the `hidden spring‚ of the title. Consciousness should not be confused with intelligence. It is perfectly possible to feel pain without any reflection as to what the pain is about. Likewise, the urge to eat – a feeling of hunger – need not imply any intellectual comprehension of the exigencies of life. Consciousness in its elemental form, namely raw feeling, is a surprisingly simple function.“
Bedeutet diess, dass wir bisher an der „falschen Stellen“ gesucht haben, weil wir Bewusstsein immer mit kognitiver (menschlicher) Intelligenz gleichgesetzt und immer nur im Bereich des Cortex verortet haben?
Andererseits gibt es durchaus Philosophen, die zwischen Bewusstsein (im Sinne von innerem Erleben) und Intelligenz unterscheiden. Z. B. schreibt Peter Bieri: „Es gibt in einem Organismus zahllose Rückkoppelungsmechanismen [die zu intelligentem Verhalten führen – A. S.] ohne das geringste Erleben: warum könnte nicht unser gesamtes Selbstmodell vorhanden sein, aber kein Erleben?”
- Ist Bewusstsein ein purer Luxus und im Grunde für den Fortgang der Welt überflüssig? (s. „Zombieproblem“)
- Müsste man vielleicht nicht stärker, wie in Ihrem Buch vorgeschlagen, die Gefühle und Affekte oder auch das Embodiment und Embededdness in der Aufklärung des Phänomens Bewusstsein beachten, um diesem Neurozentrismus im cerebralen Cortex zu verhindern?
- Ist es vielleicht nur unsere anthropozentrische Sichtweise, die uns den Zugang zum Problem versperrt, wenn wir immer von unserem menschlichen Bewusstsein ausgehen und Bewusstsein im Allgemeinen vielleicht eine viel „einfachere Funktion“ ist: „Consciousness in its elemental form, namely raw feeling, is a surprisingly simple function.“?
- Oder ist man durch diesen Standpunkt schon ein Panpsychist?
3. Wenn dem aber so sei und die naturalistischen Prinzipien auch für das Bewusstsein gelten mögen, wäre es dann nicht auch theoretisch möglich eine Form von „künstlichem Bewusstsein“ („AC/DC = „artificial consciousness/digtital consciousness“) auf einer Maschine zu simulieren, die nicht nur über einen entsprechenden Algorithmus, sondern ebenfalls über sensomotorische Inputs, Backpropagation für ihr predictive coding/procsesing und affektive Feedbackloops verfügt?
- Könnte man vielleicht auf Basis von Antonio Damasio’s „Theory of Consciousness“ aus den 3 Stufen zur Entwicklung eines Bewusstseins 1. „fundamental protoself„, 2. „core consciousness“ und 3. „extended consciousness“ eine entsprechende „Bauanleitung für Künstliches Bewusstsein“ entwickeln, wenn man hierbei die Gefühle und Affekte beim unsupervised und reinforcement learning von Maschinen entsprechend berücksichtigt?
4. Aus Ihrer Zusammenarbeit mit Karl Friston, den renommierten britischen Neurowissenschaftler am University College London, der sich mit mathematischen Modellen für bildgebende Verfahren in den kognitiven Neurowissenschaften und der Gehirnkartierung beschäftigt, ist ein Paper „How and Why Consciousness Arises: Some Considerations from Physics and Physiology“ (2018) entstanden.
Hierin und in einem weiteren Artikel „The Hard Problem of Consciousness and the Free Energy Principle“ (2019) versuchen Sie das von Karl Friston entwickelte Konzept des „free energy principle“ für die Lösung des „hard problem of consciousness“ fruchtbar zu machen.
- Könnten Sie kurz das Konzept des „free energy principle“ erläutern und hierbei erklären, warum sie es zur Lösung des „hard problems“ für eine mögliche Lösung halten?
- Lässt sich aus Ihrer Sicht aufgrund des Konzeptes einer „erweiterten Homöostase“, die auch die Gefühle/Affekte explizit miteinbezieht ein schlüssiger Funktionalismus für das „free energy principle“ oder „predictive coding/processing“ ableiten?
- Falls dieser Funktionalismus anwendbar wäre, was bedeutet dies für die eventuellen technologischen Möglichkeiten einer „multiplen Realisierung“ in Form des oben erwähnten „künstlichen Bewusstseins“ auf Maschinen?
- Sie haben sich auch intensiv mit der Bedeutung von Träumen befasst. Denken Sie, dass eine hochentwickelte KI träumen könnte? „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ wie in dem dystopischen Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Philip K. Dick aus dem Jahr 1968.
Das vollständige Interview ist auf unserem Youtube-Kanal „Zoomposium“ unter folgendem Link erschienen:
(c) Dirk Boucsein (philosophies.de), Axel Stöcker (die-grossen-fragen.com)
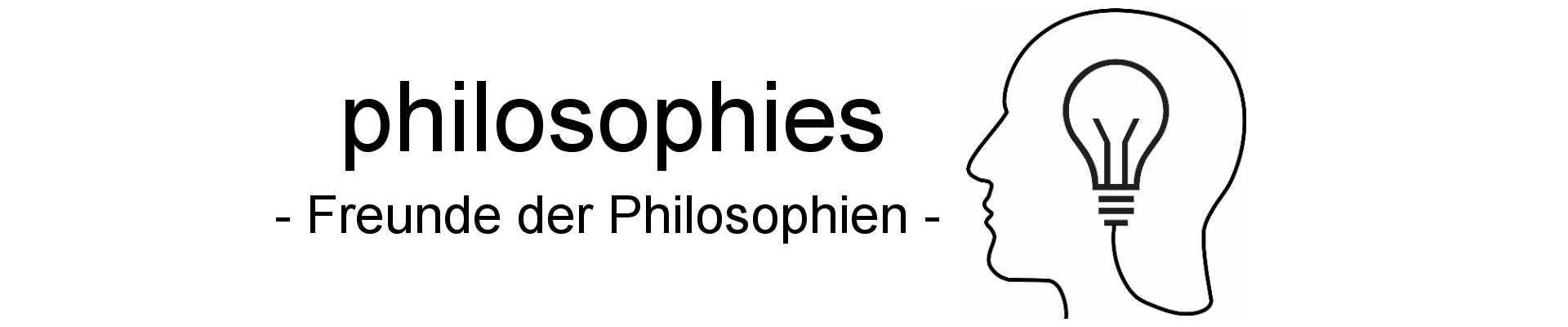



 https://orcid.org/0009-0008-6932-2717
https://orcid.org/0009-0008-6932-2717