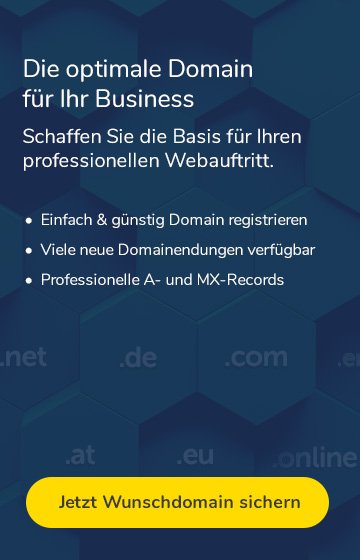Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist zwar ein Wortungeheuer – aber eines, das Gutes im Schilde führt. Denn es versteht sich als Meilenstein zu einer inklusiven Gesellschaft. Das Gesetz weist Hersteller und Dienstleister an, bestimmte Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie auch für Menschen mit Beeinträchtigung problemlos nutzbar sind.
Erstmals wird mit diesem Gesetz auch die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet, nachdem öffentliche Stellen bereits seit 2021 (nach der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung / BITV) zur barrierefreien Gestaltung von Websites und Dokumenten verpflichtet sind.
In diesem Artikel lesen Sie, welche Websites von dem Gesetz betroffen sind und welche Pflichten im Bereich Barrierefreiheit damit verbunden sind.
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz – rechtliche Hintergründe
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz wurde am 20. Mai 2021 verabschiedet und am 22. Juli 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Sein offizieller Name ist noch ein wenig furchteinflößender: „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (BFSG)“. Damit setzt der deutsche Gesetzgeber die EU-Richtlinie des European Accessibility Act (EAA) um. Ziel sowohl der Richtlinie als auch des Bundesgesetzes ist eine diskriminierungsfreie Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen und älteren Menschen.
Demnach müssen bestimmte Produkte, die nach dem 28. Juni 2025 in Verkehr gebracht werden, barrierefrei sein. Gleiches gilt für bestimmte Dienstleistungen, die nach diesem Stichtag angeboten werden. Dazu zählen insbesondere die sogenannten Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr (Online-Handel).
Bei Verstößen gegen das Gesetz können die zuständigen Marktüberwachungsbehörden der Länder (diese sind Stand November 2023 noch nicht bekannt) verschiedene Maßnahmen verhängen. Diese reichen von einer Aufforderung zur Nachbesserung bis zur Einstellung des elektronischen Geschäftsverkehrs, falls wiederholten Aufforderungen nicht nachgekommen wurde. Zudem können Verbraucher bei der zuständigen Marktüberwachungsbehörde Maßnahmen zur Beseitigung von Verstößen beantragen. Verbänden steht die Möglichkeit einer Verbandsklage offen.
Vorsätzliche und fahrlässige Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit und können nach Paragraph 37 BFSG mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro bestraft werden.
Welche Websites unterliegen dem BFSG?
Alle vom Gesetz betroffenen Produkte und Dienstleistungen sind in Paragraf 1, Absatz 2 (Produkte) und Absatz 3 (Dienstleistungen) abschließend aufgelistet. Demnach unterliegen Websites von Telekommunikationsdiensten, Personenbeförderungsdienstleistern und Banken (§1 Abs. 3 Nummer 1-3) in jedem Fall den gesetzlichen Regelungen.
Für alle anderen Webseiten sind vor allem die „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“ (§1 Abs. 3 Nummer 5) relevant. Da der Punkt sämtliche geschäftliche Transaktionen umfasst, die über eine Website vorgenommen werden können, unterliegt der gesamte Online-Handel dem BFSG. Gemäß den „Leitlinien zur Anwendung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes“ müssen zudem alle Webseiten zur Kontaktaufnahme, Terminbuchung und anderen Interaktionsmöglichkeiten die gesetzlichen Anforderungen erfüllen (Abschnitt B, Beispiel 3). Das gilt auch für Webseiten außerhalb von E-Commerce-Sites, wie die Leitlinien am Beispiel eines Friseurgeschäfts verdeutlichen, das Online-Terminbuchungen anbietet.
Welche Ausnahmen gibt es?
Das BFSG zielt auf die Rechte von Endkunden bzw. Verbrauchern. Damit sind rein private Websites sowie solche, die ausschließlich auf Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B) zielen, nicht von dem Gesetz betroffen. Auch Kleinstunternehmen, die für das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz relevante Dienstleistungen anbieten, müssen aufgrund ihrer geringen Größe die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen. Paragraf 2 Nummer 17 definiert dabei Kleinstunternehmen als Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigte und entweder einem Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro.
Auch Dienstleistungen, die vor dem Inkrafttreten des BFSG erbracht wurden, unterliegen diesem nicht. Im Fall von Websites dürfte dies beispielsweise Videos und Dokumente (PDFs) betreffen, die vor dem 28. Juni 2025 produziert bzw. publiziert wurden – solange es sich nicht um Seiten mit interaktiven Inhalten wie Kontaktformularen handelt.
Wenn Sie jedoch unsicher sind, ob Ihre Website und damit ggf. erbrachte Dienstleistungen unter die gesetzlichen Vorgaben des BFSG fallen, sollten Sie Ihren Rechtsbeistand zu Rate ziehen.
Was fordert das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für Websites?
Die Anforderungen des BFSG basieren im Wesentlichen auf der europäischen Norm für digitale Barrierefreiheit DIN EN 301549, die sich sowohl auf Produkte als auch auf Dienstleistungen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie bezieht. In Bezug auf Webinhalte orientiert sich die Norm weitestgehend an dem internationalen Standard „Richtlinien für barrierefreie Webinhalte“ (WCAG 2.1), der vom World Wide Web Consortium (W3C) ausgearbeitet wurde.
Die Richtlinien enthalten zu allen relevanten Aspekten des barrierefreien Webdesigns sehr detaillierte Angaben – beispielsweise zu Kontrastverhältnissen oder Textformatierungen und Zeilenabständen. Dabei werden die Anforderungen in drei Konformitätsstufen (A, AA, AAA) eingeteilt, wobei „A“ die Minimalanforderungen bezeichnet. Relevant in der Europäischen Union ist die Konformitätsstufe AA.
Die WCAG betrachten Barrierefreiheit unter vier Aspekten, den „Vier Prinzipien der Barrierefreiheit“: Wahrnehmbarkeit (perceivable), Bedienbarkeit (operable), Verständlichkeit (understandable) und Robustheit (robust). Daraus leiten sich folgende grundsätzliche Anforderungen ab, die eine barrierefreie Webseite erfüllen muss:
- Wahrnehmbarkeit: Informationen und Komponenten der Benutzeroberfläche müssen für die Benutzer so darstellbar sein, dass sie diese auch wahrnehmen können. Beispielsweise müssen visuelle Inhalte auch für Sehbehinderte und blinde Menschen über Alternativen darstellbar sein.
- Bedienbarkeit: Sämtliche Funktionen der Website müssen so gestaltet sein, dass sie auch von Menschen mit Einschränkungen nutzbar sind. Mögliche Interaktionen müssen klar erkennbar sein.
- Verständlichkeit: Nutzer müssen in der Lage sein, alle Informationen und die Bedienung der Benutzeroberfläche zu verstehen.
- Robustheit: Die Webseiten müssen von unterschiedlichen Endgeräten, einschließlich unterstützender Technologien, zuverlässig interpretiert werden können. (Das schließt auch die Nutzung durch zukünftige Geräte ein.)
Webseiten, die die Anforderungen der WCAG-Richtlinien umsetzen – und damit auch die der darauf basierenden Norm DIN EN 301549 – dürften dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz voll umfänglich entsprechen. Zwar werden die Richtlinien und die Norm im BFSG nicht explizit genannt, aber § 4 BFSG („Konformitätsvermutung auf der Grundlage harmonisierter Normen“) legt nahe, dass DIN EN 301549 hier als Maßstab genommen werden kann.
Über die Erfüllung der normativen Anforderungen hinaus müssen Websites, die dem BFSG unterliegen, zwei weitere Bedingungen erfüllen: Es muss eine „Erklärung zur Barrierefreiheit“ bereitgehalten werden; darin enthalten Informationen darüber, wie Barrierefreiheit auf der Website sichergestellt wird, und darüber, welche Teile der Website (noch) nicht barrierefrei sind. Die Erklärung selbst muss natürlich barrierefrei und auch barrierefrei zugänglich sein. Zudem muss eine Kontaktmöglichkeit bereitgestellt werden, über die verbliebene Barrieren gemeldet werden können.
Zusammengefasst sollten betroffene Websites also:
- den Anforderungen der DIN EN 301459 bzw. der WCAG-Richtlinien entsprechen,
- eine barrierefrei zugängliche „Erklärung zur Barrierefreiheit” enthalten,
- eine Kontaktmöglichkeit bieten, über die Barrieren gemeldet werden können.
Detaillierte Infos und Tipps, wie Sie Ihre Website barrierefrei designen, finden Sie in folgenden Blogbeiträgen:
- Barrierefrei fängt bei der Struktur an: Joomla Templates mit landmarks & roles
- WordPress und digitale Barrierefreiheit
- Verbessern Sie Ihre Conversion Rate durch Barrierefreiheit und bessere Usability für Onlineshops
Fazit – was Websitebetreiber nun tun sollten
Mit Stichtag 28. Juni 2025 müssen alle Websites, über die Verbraucher geschäftliche Transaktionen vornehmen können, ebenso wie solche, die Interaktionen wie z. B. Terminvereinbarungen anbieten, die Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes erfüllen. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Webpräsenz dem BFSG unterliegt, sollten Sie eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Hinweise, welche Änderungen an Ihrer derzeitigen Website vorgenommen werden müssen, erhalten Sie mit einer systematischen Überprüfung Ihrer Seiten, beispielsweise mit einer BITV-Selbstbewertung, dem Schnelltest barrierefreie Webseite der Stiftung „barrierefrei kommunizieren“ oder dem WAVE web accessibility evaluation tool.
Titemotiv: Bild von Pete Linforth auf Pixabay
- Die meisten Webseiten haben Probleme mit der Barrierefreiheit, unabhängig von der Branche. - 13. Mai 2024
- Was Websitebetreiber über das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wissen sollten - 8. Mai 2024
- 21 Jahre WordPress: Ein Tool, das das Internet geprägt hat – Jetzt Jubiläumsangebote sichern - 3. Mai 2024