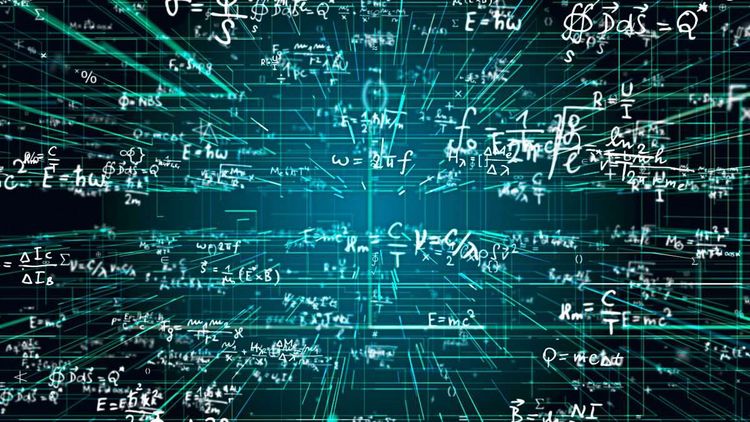
Die Beziehungsgeschichte von Physik und Philosophie gleicht einer emotionalen Achterbahnfahrt mit etlichen Höhen und Tiefen. Historisch waren diese beiden Sphären des Denkens lange nicht scharf getrennt. Wie die Überlieferungen der großen Denker des Ostens und des Westens zeigen, sind in die Betrachtungen der Welt und der Gestirne sowohl physikalische wie auch philosophische, poetische und politische, aber auch religiöse Aspekte eingeflossen. Die disziplinäre Schubladisierung entlang von Forschungsgegenständen und Untersuchungsmethoden hat sich erst viel später vollzogen und ist nach wie vor voll im Gange.
Wenig überraschend halten sich die großen Probleme unserer Zeit nicht an akademische Fachgrenzen, und so kommt es, dass interdisziplinäre Ansätze stark nachgefragt und auch gerne gefördert werden. In der Praxis stellen sich bei interdisziplinären Ambitionen dennoch rasch große Herausforderungen ein, wie auch die Forschung von Gemma De les Coves zeigt. Die katalanische Physikerin ist seit etlichen Jahren an der Universität Innsbruck tätig, ihre Forschung wird unter anderem durch einen prestigereichen Start-Preis des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF gefördert. Indem sie die Grenzen zwischen Physik, Mathematik und Informatik überwindet, versucht De les Coves mit ihrem Team herauszufinden, wie Systeme auf Basis weniger Regeln eine überraschende Komplexität hervorbringen können. Bei ihrer Spurensuche zwischen Komplexität und Einfachheit stößt sie aber immer wieder auf philosophische Fragen.

Philosophische Verwirrungen
Ein Knackpunkt für ihre Forschung ergibt sich etwa aus der Frage, wie wir mit Unendlichkeiten umgehen. "Ich würde argumentieren, dass wir – da wir endliche Wesen sind – nur dann mit unendlichen Dingen umgehen können, wenn diese durch eine endliche Beschreibung gefasst werden können." Genau solche Beschreibungen versucht De les Coves mit ihrer Forschung zu ergründen. Je tiefer sie in ihrer Arbeit vorgedrungen ist, umso klarer sei für sie geworden, dass sie sich mit den philosophischen Grundlagen befassen müsse. De les Coves vertiefte sich in Metaphysik, sie las Graham Priest und andere. Jedoch mit zweifelhaftem Erfolg: "Nachdem ich all diese Philosophie gelesen habe, bin ich leider sehr verwirrt und desorientiert. Viele der Begriffe des gesunden Menschenverstands, die ich intuitiv zu verstehen glaubte, stelle ich jetzt infrage." Nach der Lektüre von Physik- oder Mathematikbüchern sah sie die Welt klarer vor sich als zuvor. "Ich hatte das Gefühl, mehr zu wissen als vor der Lektüre des Buches." Ihr Exkurs in die Philosophie hinterließ sie aber mit dem gegenteiligen Gefühl: "Ich weiß nicht mehr, ob es Zeit gibt oder was eine Ursache ist. Ich weiß nicht, was Akteure sind oder was ein Kreis sein soll."
Zwar schätze sie die Bereitschaft von Fördergebern, interdisziplinäre Ansätze zu unterstützen. In der Praxis ergeben sich aber etliche Probleme. "Meiner Erfahrung nach ist es wirklich sehr schwer, sich in ein neues Gebiet zu wagen." Es gebe so viel Wissen, das man sich aneignen müsse, und es fehlten zuverlässige Bewertungsindikatoren für interdisziplinäre Projekte. "Deshalb stößt man am Ende oft auf Widerstand", berichtet De les Coves. "Ich denke trotzdem, dass es notwendig ist: Wir brauchen sowohl die Spezialisten auf einem Gebiet als auch jene Leute, die imstande sind, Verbindungen herzustellen. Beides sollte in einem reichhaltigen wissenschaftlichen Umfeld vorhanden sein."
Turbulente Beziehungsgeschichte
Im Laufe des 20. Jahrhunderts gestaltete sich das Verhältnis von Physik und Philosophie besonders turbulent – mit gravierenden Folgen. Wie es zu dieser angespannten Stimmung kam, erschließt sich in der historischen Betrachtung: Im zu Ende gehenden 19. Jahrhundert galt die Physik weitestgehend als vollendet. Dem späteren Physiknobelpreisträger Max Planck, der zu dieser Zeit sein Studium aufnahm, wurde empfohlen, sich ein anderes Fach zu suchen, denn in der Physik sei alles erledigt. Nur ein paar kleine Anomalien hier und da wollten nicht so recht ins Weltbild der klassischen Physik passen. Dass diese mehrere wissenschaftliche Revolutionen in Gang setzen sollten, ahnte damals noch kaum jemand.
Im beginnenden 20. Jahrhundert änderte sich das rasant, und das hatte einerseits mit der Entwicklung der Relativitätstheorie durch Albert Einstein, andererseits mit der Begründung der Quantenmechanik durch Planck und andere zu tun. Sowohl Einstein wie auch die Gründungsdenker der Quantenphysik rühmten sich mit ihren philosophischen Betrachtungen, die sie zu physikalischen Neuentdeckungen gebracht hätten. "Seit Einstein gibt es keine Entfremdung mehr zwischen Physikern und Philosophen. Die Physiker sind zu Philosophen geworden, und die Philosophen hüten sich, mit der Physik in Konflikt zu geraten", beschrieb etwa der deutsche Mathematiker und Physiker Arnold Sommerfeld den damaligen Beziehungsstatus zwischen Physik und Philosophie.
Dass die meisten Physiker dieser Zeit eher Selfmade-Philosophen waren und kaum vertraut mit dem althergebrachten philosophischen Kanon waren oder diesen gar brüsk ablehnten, kommt in einer Selbstbeschreibung des österreichischen Physiknobelpreisträgers Wolfgang Pauli prägnant zum Ausdruck: "Zur Orientierung der Philosophen möchte ich von vornherein klarstellen, daß ich nicht zu einer der philosophischen Schulen gehöre, deren Namen mit einer Art von 'Ismus' enden. Darüber hinaus bin ich sehr dagegen, irgendeine spezielle physikalische Theorie, wie die Relativitätstheorie oder die Quanten- oder Wellenmechanik, unter einen dieser 'Ismen' zu bringen, obwohl dies von Zeit zu Zeit sogar von Physikern so gemacht worden ist."
Shut up and calculate
Nach der ersten Euphorie der Gründungsjahre der modernen Physik traten philosophische Fragen jedoch ab den 1930er-Jahren wieder verstärkt in den Hintergrund. Ein pragmatischerer Zugang zur Wissenschaft gewann die Oberhand. "Shut up and calculate" lautete jene Maxime, die zum Ausdruck bringen sollte, dass philosophische Fragestellungen hintangestellt werden sollten und stattdessen klare Ergebnisse produziert werden sollten. Dieser neue Zeitgeist war auch politisch motiviert, wie der Physiker und Wissenschaftshistoriker David Kaiser vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA, in seinem Buch How the Hippies Saved Physics darlegte: Während des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges gab es die Bemühung, die Physikausbildung so zu gestalten, dass sie kriegsdienliche Vorhaben unterstützt. Philosophische Überlegungen über die Natur von Raum und Zeit zählten dazu freilich weniger als exzellente Ingenieursleistungen zum Bau von Kernreaktoren. Für etliche Jahrzehnte wurden philosophische Zugänge zur Physik nicht nur nicht gefördert, sondern auch aktiv abgedreht.
Erst langsam drehte sich die Stimmung in den 1970er-Jahren, als sich eine neue Generation von Physikern wieder den konzeptuellen Fragen zuwandte. Aus dieser neuen Offenheit resultierte schließlich auch die Quanteninformationstheorie, zu der etliche Persönlichkeiten beigetragen haben, von denen inzwischen viele Nobelpreisträger sind: Anton Zeilinger, Alain Aspect, David Windeland oder Serge Haroche.
Physik, Philosophie und Poesie
Für Nachwuchsforscherinnen wie Gemma De les Coves ist klar: "Die Physik braucht die Philosophie, und die Philosophie braucht die Physik." Dass interdisziplinäre Forschungsansätze aktuell so bedeutsam seien, begründet sie mit einigen offenen Fragen, die nach wie vor ungelöst sind: "In der Physik wissen wir, wie wir die Vergangenheit und die Zukunft berechnen können, aber wir haben keine Meinung dazu, ob die Zeit existiert. Wir wissen, dass eine Kraft eine Beschleunigung verursacht, aber wir wissen nicht, was eine Ursache ist. Und darüber hinaus ist es nicht klar, was ein Akteur ist. Das ist aber aus existenziellen Gründen wichtig, und auch in der Quantenphysik, um zu verstehen, was bei der Messung vor sich geht."
Wie noch eine weitere Komponente in das interdisziplinäre Geflecht passt, damit beschäftigt sich De les Coves in ihrem ersten Buch, das sie demnächst fertigstellen will und das an der Schnittstelle von Physik, Philosophie und Poesie angesiedelt ist. Eine der Fragen, die sie dabei interessieren, ist: "Kann die Kunst einige der Beschränkungen überwinden, die logische Systeme wie jene der Mathematik und Physik begrenzen?" Ein weiteres Kapitel in einer komplexen Beziehungsgeschichte scheint vorprogrammiert. (Tanja Traxler, 19.5.2024)