Es ist ein bisschen mehr als nur ein Begleitband zu Cornelia Lotters 2023 erschienenem Roman „Die falsche Heimat“, auch wenn er die Gespräche beinhaltet, welche die Leipziger Autorin teilweise in ihrer Geschichte um Veronika und ihre späte Beschäftigung mit den hochaktuellen Themen Flucht und Vertreibung verwendet hat. Denn eigentlich ist nichts dramatischer als die Geschichte, wie sie den Betroffenen tatsächlich passiert ist.
Das können Geschichtsbücher nicht darstellen. Doch in den Erinnerungen der Menschen, die es überlebt haben, ist es präsent. Gerade dann, wenn diese spezielle Kapitel in der Wahrnehmung der Gesamtgesellschaft kaum eine Rolle spielen darf. Oder anders rezipiert wird als die tatsächliche Tragödie, die die Millionen Menschen tatsächlich erlebt haben, als sie im eisigen Winter 1944/1945 vor der heranrollenden Front mit völlig unzureichenden Mitteln fliehen mussten.
Hunderttausende starben dabei. Kinder verloren ihre Mütter, Mütter ihre Kinder. Die Männer waren meistens an der Front und konnten nicht helfen. Und einer der wilden Befehle Adolf Hitlers verhinderte, dass die Menschen aus den bis dahin ostdeutschen Gebiete rechtzeitig und geordnet den Treck nach Westen antreten konnten. Das Chaos war gewollt.
Und es erzählt natürlich auch in diesem Fall von der Menschenverachtung des Nationalsozialismus, der ständig von „Volksgenossen“ schwadronierte – aber im Winter 1944/1945 gerade die Schutzlosesten mittenhinein in die heranrollenden Kriegsereignisse schickte.
Flucht im Chaos
Und Cornelia Lotter hat wohl die letzte Gelegenheit genutzt, mit einigen diese Menschen, die die Flucht aus dem Osten noch als Kinder erlebt haben, zu sprechen. Sie war selbst verblüfft, dass diese heute hochbetagten Menschen sich noch detailreich an diese Erlebnisse erinnern konnten.
Das hat sich eingebrannt fürs Leben – auch weil es mit permanenter Angst, Lebensgefahr, körperliche Bedrohung, aber auch dem Verlust geliebter Menschen einherging. Ganz zu schweigen vom unvollkommenen Abschied von der vertrauten Heimat. Denn die Meisten brachen mit der Erwartung auf, in ein paar Wochen wieder zurückkehren zu können.
Aus den Wochen aber wurden Jahre. Einige – gerade die aus Schlesien Geflüchteten – versuchten noch im Jahr 1945 wieder zurückzukehren in ihre Heimatorte. Doch die Versprechungen entpuppten sich für die Meisten als neue Enttäuschung. Und gerade weil Cornelia Lotter die Interviewpartner die Geschichte aus ihrer ganz persönlichen Erinnerung heraus erzählen lässt, wird deutlich, welch ein Chaos da im letzten Kriegsjahr herrschte.
Ein Chaos, das auch mit den Beschlüssen der Alliierten zu tun hatte, von denen die Menschen auf den vereisten Straßen und Feldwegen nichts wussten. Schon gar nicht von Stalins rücksichtslosem Wunsch, die Grenzen nach dem Krieg endgültig und dauerhaft zu verschieben.
Was gleich die nächste Katastrophe beinhaltete, denn das bedeutete eben auch, dass die Sowjetunion ihre Westgrenze bis zu der Teilungslinie vorschob, an der Deutschland und die SU schon 1939 im Hitler-Stalin-Pakt die Grenze zwischen ihren Imperien gezogen und Polen zerschnitten hatten. Das bedeutete auch für Millionen Polen, die bisher in Ostpolen lebten, dass sie nach Westen verdrängt wurden – in die zuvor deutschen Ostgebiete, die nun zu Polen kamen.
Suche nach einem neuen Heimischwerden
Dass das noch mitten im Fluchtgeschehen für weitere Konflikte und Übergriffe sorgen würde, war abzusehen. Die zwölf Frauen und Männer, die Cornelia Lotter gesprochen hat, erzählen anschaulich von dem, was sie erlebten. Das Besondere an den Interviews ist: Erstmals kommen Menschen zu Wort, die im heutigen Ostdeutschland geblieben und aufgewachsen sind und hier ihr Erwachsenenleben verbracht haben.
Denn dominiert wird die Literatur zu Flucht und Vertreibung bislang von der westdeutschen Perspektive, für die es – anders als in der DDR – keine Tabus gab. Das bestimmt die Interpretationen bis heute.
Und es verstellt den Blick darauf, dass Ostdeutschland über drei Millionen dieser geflüchteten Menschen aus Pommern, Ostpreußen, Schlesien – aber auch dem Sudetenland – aufgenommen hat. Menschen, die sich hier versuchten zu integrieren, auch wenn sie hier genauso auf Ablehnung stießen wie in Bayern. Denn natürlich war kein einziger Landesteil darauf eingerichtet, so viele Menschen unterzubringen.
Die Großstädte waren in Ost wie West zerbombt. Viele Flüchtlingstrecks strandeten ja bekanntlich in Dresden und gerieten so im Februar 1945 mitten hinein in den Feuersturm, der die Stadt zerstörte.
Aber die Menschen, die hier zu Wort kommen, erzählen eben auch vom Ankommen, von der Suche nach einem Ort, an dem sie bleiben und sich – unter Entbehrungen – eine neue Existenz aufbauen konnten. Und gefragt hat Cornelia Lotter sie auch nach ihren Erfahrungen bei späteren Besuchen in der alten Heimat. Erfahrungen, die ebenfalls von der Zeit abhingen
. Denn jene, die schon in den 1960er Jahren den Weg in ihre alte Heimat suchten, trafen nicht nur auf allzu verständliches Misstrauen bei den Menschen, die jetzt in ihren einstigen Häusern lebten und die sich noch viele Jahre davor fürchteten, dass die Oder-Neiße-Grenze doch wieder infrage gestellt werden würde. Sie lebten meist noch in Städten, die genauso wie viele Städte in der DDR noch immer die Kriegsschäden aufwiesen, zu deren Reparatur das Geld fehlte.
Unersetzliche Erinnerungen
Auch in Polen kam der Wiederaufbau der zerstörten Städte nur mühsam in Gang. Doch als dann die Kinder und Enkel nach der deutschen Wiedervereinigung kamen, fanden sie Städte vor, die liebevoll wieder in ihrer alten Schönheit aufgebaut worden waren. Und wo Menschen lebten, die nun selbst neugierig auf die Geschichte der einst deutschen Orte waren.
Was auch für die jetzt alt gewordenen Kriegskinder ein wichtiger Teil der Versöhnung war und der Möglichkeit, die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen. Oft waren diese Begegnungen zutiefst menschlich und gastfreundlich.
Und gerade deshalb ist es so wichtig, wie auch Cornelia Lotter einschätzt, dass die Erinnerung an die letzten Kriegstage bewahrt werden – in all ihrer Bedrängnis und Bitterkeit. Denn wenn wir vergessen, was Kriege auch unter den Frauen und Kindern anrichten, die in die Kriegsmaschinerie geraten und unter widrigsten Bedingungen eine Flucht über hunderte Kilometer antreten müssen, dann gerät Krieg nur zu schnell zu einem „Kampf unter Männern“, werden die Heldengesänge laut und das Leid verschwindet aus den Geschichtsbüchern.
Kleine weiße Friedenstaube
Besonders freute sich Cornelia Lotter, dass sie sogar die Schöpferin des Liedes von der kleinen weißen Friedenstaufe, Erika Schirmer, in Nordhausen treffen konnte. Was nicht nur wegen der Berühmtheit ihres Kinderliedes berührt, sondern weil das Lied heute wieder so vertraut und uneinlösbar klingt. Es sind ja nicht nur die ganz Alten, die sich Frieden wünschen. Es sind auch die Jungen, während wieder ein Kriegsherr ohne Skrupel ein Land verwüsten lässt.
Sodass das Thema Flucht und Vertreibung wieder auf der Tagesordnung steht. Ein Thema, das man völlig anders betrachtet, wenn die Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs noch lebendig sind und die Jüngeren die Trauer der Alten nicht einfach abtun.
Und das trifft nicht nur auf die aus der Ukraine geflohenen Menschen zu. Dass auch die Menschen aus dem globalen Süden vor Krieg und Bürgerkrieg geflohen sind, wird nämlich zumeist auch negiert, versteckt hinter bürokratischen Versuchen, die eine Flucht für berechtigt, die nächste für illegal zu erklären. Als hätten die Menschen, die um ein Obdach bitten, nicht auch ihre Heimat verloren. Eine Heimat, von der man – so lange kein Kriegsherr wütet – immer denkt, sie wäre sicher und man wäre darin gut aufgehoben.
Doch dann spielen die Herren der Welt wieder einmal Krieg, toben ihren Narzissmus auf dem Rücken der Wehrlosen aus. Und denken nicht einmal daran, dass ihre Kriege Millionen Menschen auf eine Flucht zwingen, die ins Ungewisse führt.
Mit dem Maler Gerhard Wendenhorst würdigt Cornelia Lotter auch einen dieser Heimatlos-Gewordenen, den sie nicht mehr fragen konnte, dessen Sehnsucht nach der verlorenen Heimat aber in seinen Notizbüchern und Bildern überdauert hat. Nur zu gern hätte sie den längst Verstorbenen auch seine persönliche Geschichte erzählen lassen.
So ist es zumindest ein Essay geworden, der davon erzählt, was auf einmal fehlt, wenn man nicht mehr fragen kann.
Cornelia Lotter „Vom Fortgehen und Ankommen“ tolino media, Leipzig 2023, 15,99 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
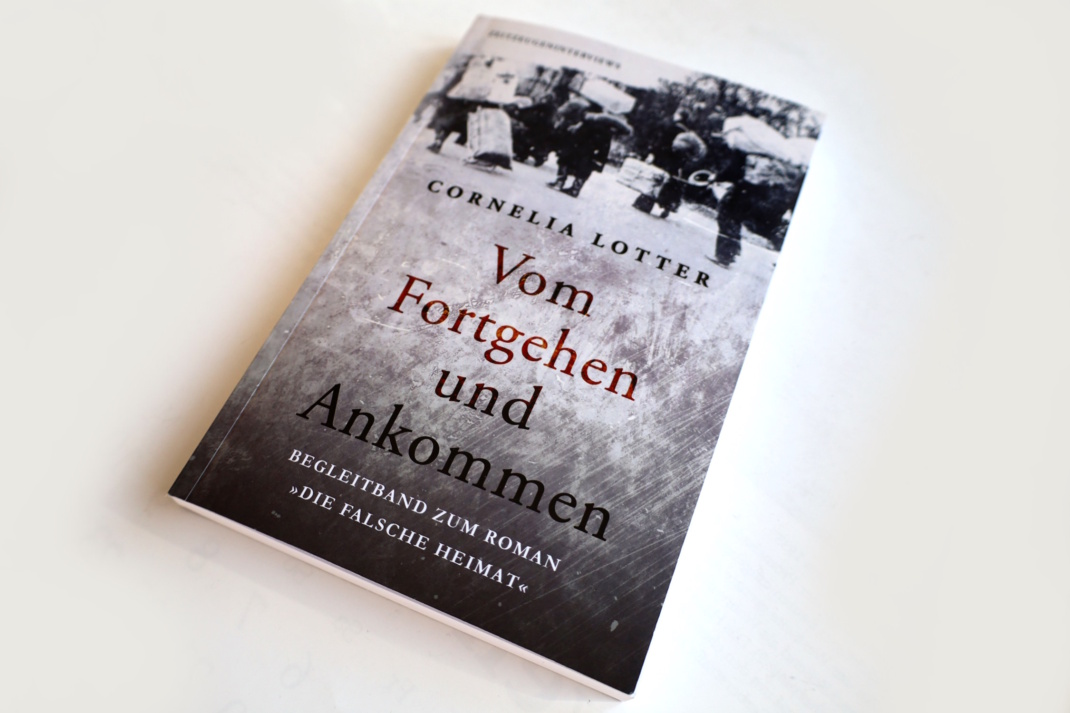











Keine Kommentare bisher