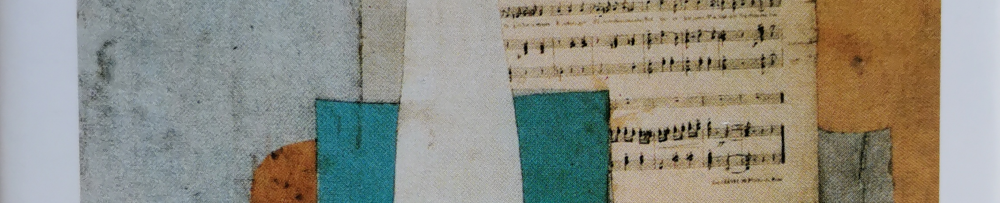Konsequenz eines längeren Leselebens ist es unter anderem, dass die ganz großen Leseerlebnisse immer seltener vorkommen. Mit welcher Freude, welchem Erstaunen, welchem Entzücken habe ich früher nicht Seite um Seite umgeblättert in Joyce’ Ulysses, Hugos Elenden oder Melvilles Moby-Dick. Ich lese anders heute (und heute anders als gestern). Es ist immer noch ein Vergnügen, aber vieles bei diesem heutigen Vergnügen besteht nun darin, Spuren und Zusammenhänge zu sehen, ohne großartig darüber nachdenken zu müssen. Allein – das pure Staunen früherer Jahre wird immer seltener, und manchmal bedaure ich das.
Hier aber habe ich ein Buch gefunden, bei dem ich wieder einmal in helles Entzücken geriet. Auf etwas mehr als 200 Seiten gelingt Ruth Rehmann hier,
- eine fiktive Künstlerbiografie zu zeichnen (eigentlich sogar eine Doppel-Biografie, nämlich einer Künstlerin, die reüssiert hat, und einer, die es nicht geschafft hat)
- ein psychologisches Kammerspiel über die Beziehung einer großen Maestra zu ihrer kleinmütigen Meisterschülerin zu liefern
- musiktheoretische Aperçus einzuflechten
- die untergeordnete Stellung der Frau in der klassischen Musik anzuprangern
- eine Geschichte der Aufführungspraxis klassischer Musik vom Ende der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis in die junge BRD zu skizzieren
- und last but not least dies alles organisch um die Gestalt der Protagonistinnen zu gruppieren.
Diese Protagonistin ist einerseits die Geigenvirtuosin Clara Schumacher – die so heißt, weil ihr Vater, ein sehr begabter Amateur-Violonist, offenbar der Meinung war, dass da eine große Musikerin heranwachsen würde und sie deshalb nach dem berühmten Vorbild ‚Clara‘ taufen ließ. Clara ist dabei die sprichwörtliche Katze, die in ihrem Leben immer auf die Füße fällt. Mit großer Schlauheit nützt sie die Menschen um sich herum aus. Das ist jedenfalls das Bild, das Hanna Steinbrecher, die Ich-Erzählerin und in gewissem Sinn Antagonistin, uns von ihr gibt. Hanna hat früher selber Violine gespielt und war Teilnehmerin an der Meisterklasse der Maestra. Sie hat sich nach einem Desaster, dessen genauen Inhalt sie lange vor uns Lesenden verheimlicht, selber aus der Welt der klassischen Musik zurückgezogen. Aktuell arbeitet sie beim Feuilleton einer Tageszeitung, bis ein Freund der Maestra sie anfragt, ob sie sich vorstellen könne, mit ebendieser in ein Hotel bei Leoben einzuziehen. Die Maestra sei erschöpft und brauche Ruhe. Gleichzeitig suche sie jemand, der ihr dabei helfe, ihre Autobiografie zu schreiben. Nach anfänglichem Zögern sagt Hanna zu. Schon in der ersten Nacht macht sie aber offenbar alles falsch und will den Job hinwerfen. Sie lässt sich überreden weiterzumachen, auch weil die Maestra sich plötzlich ihr gegenüber wieder bester Laune zeigt.
Wir wissen das ganze Buch durch nie, ob, was die Maestra erzählt, auch die Wahrheit ist – auch, weil es Hanna nie genau weiß. Das rundet sich dann letzten Endes zum Bild einer Person, die alles tut, um im Mittelpunkt zu stehen. Einzig die Musik, ihr Geigenspiel, stellt sie noch höher als sich selber. So erhalten wir auch einen Blick auf die komplexe Psyche einer großen Künstlerin. Daneben steht die gescheiterte Schülerin, die zu wenig Vertrauen hatte in sich und die Musik, und die auch dieses Mal zumindest gegen außen scheitern wird. Innerlich aber hat sie Klarheit gewonnen über sich, über die Maestra und über die Musik.
Meine Zusammenfassung klingt trocken und wird dem feinen Geflecht an Anspielungen und psychologischen Schachzügen des Romans so wenig gerecht wie dessen großem musikologischen Gehalt.
Am Ende flieht Hanna vor der schieren Größe und den Ränkespielen der Maestra. Sie weiß nun, dass ihre Lehrerin ihre Karriere absichtlich zerstört hat und will es ihr vor ihrem Abgang noch an den Kopf werfen, aber:
Hand auf der Klinke stehe ich vor ihrer Tür, höre sie gehen, atmen, spielen und weiß, daß ich die Klinke nicht drücken, die Tür nicht öffnen werde. Kein Weg zwischen uns außer der Musik, die sie spielt, die ich höre. Keine Möglichkeit, ihr mein Entzücken, meinen Dank, meine Trauer zu sagen.
S. 216
Und ganz ähnlich geht es mir nun mit meinem Entzücken.
Das Buch ist leider nur noch antiquarisch greifbar.
Ruth Rehmann: Abschied von der Meisterklasse. München, Wien: Hanser, 1985.