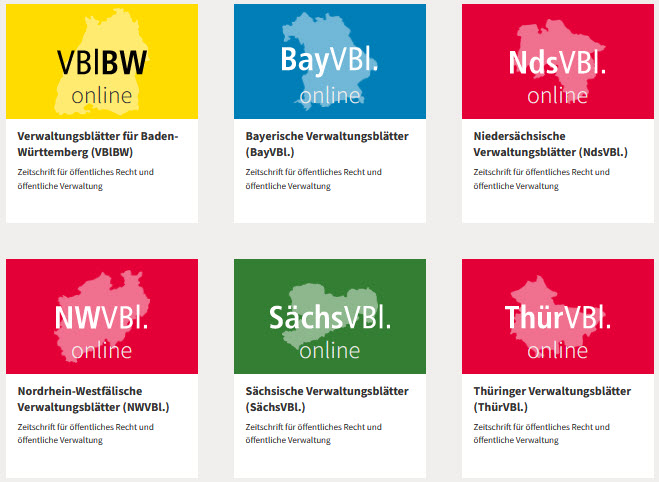Horn: „Das Grundgesetz verwehrt den Feinden der Freiheit die Berufung auf ebendiese Freiheit“
PUBLICUS-Serie zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes – Folge 2
Horn: „Das Grundgesetz verwehrt den Feinden der Freiheit die Berufung auf ebendiese Freiheit“
PUBLICUS-Serie zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes – Folge 2

Am 23. Mai 2024 wird das Grundgesetz 75 Jahre alt. Mit dieser PUBLICUS-Interviewreihe zum Jubiläum haben wir renommierte Juristinnen und Juristen befragt und ein Stimmungsbild zur deutschen Verfassung eingeholt.
Folge 2: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Detlef Horn, Professor für Öffentliches Recht am Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg
PUBLICUS: Das Grundgesetz sei eine der größten Errungenschaften der Bundesrepublik, sagten 86 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage vor fünf Jahren. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diese positive Rezeption?
Horn: Die Zustimmungswerte signalisieren: Auch nach 75 Jahren genießt die Grundordnung des Grundgesetzes jenes Grundvertrauen, das sie braucht, um wirksam zu sein, aber selbst nicht garantieren kann. In der verfassungsgeschichtlichen Perspektive ist das ein Glücksfall. Das Grundgesetz, als Staats- und als Bürgerverfassung, hat sich in der Vergangenheit bewährt und berechtigt zu der Hoffnung, auch in Zukunft ein guter und verlässlicher Kompass sein.
Es baut auf die Stabilität des gewaltenteiligen, parlamentarischen Regierungssystems, bürgt für die freiheitliche demokratische Willensbildung der Bürger, nutzt und integriert die föderalen Ideen und Kräfte, liefert die Bausteine für eine soziale und ökologische Marktwirtschaft, sichert im Horizont liberaler Rechtsstaatlichkeit die Entfaltungsfreiheiten einer offenen, pluralen Gesellschaft und sorgt für die Einbindung der deutschen Staatlichkeit in die Europäische Integration und die internationale Ordnung.
Verschiedentliche wie auch gegenwärtige Unzufriedenheiten mit der Responsivität und inhaltlichen Repräsentativität des politischen Systems provozieren seinen realen Betrieb, stellen aber seine grundlegenden Werte und Prinzipien nicht grundsätzlich in Frage.
Der in Art. 1 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Vorrang der Verfassung und die dem gemäße Konstitutionalisierung der gesamten Rechtsordnung haben das Grundgesetz zu einer „lebenden“ und „akzeptierten“ Verfassung werden lassen, die in der Lage war und ist, den beständigen Wandel der politischen, gesellschaftlichen und sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen zu verarbeiten. Zahlreiche Krisen und vielfältige Herausforderungen konnten bewältigt werden, ohne dass – trotz zuweilen harter Auseinandersetzungen und mancher Fehler – die Republik Schaden genommen oder sich ihr Grundgerüst verschoben hat.
Unterpfand dieses Erfolgs ist zumal das Bundesverfassungsgericht. Das Vertrauen in das Grundgesetz gründet sich derart auf das Vertrauen in das Karlsruher Gericht, dass das eine vom anderen zuweilen kaum zu unterscheiden ist. Keine andere staatliche Institution erfährt mehr Zuspruch, Anerkennung und Respekt. Ohne die letztverbindlichen Interpretationen und Konkretisierungen in mittlerweile 165 Entscheidungsbänden und zahlreichen Kammerbeschlüssen hätte das Grundgesetz seine (Vernunft-)Potentiale für ein freiheitlich-rechtsstaatliches und demokratisch-parlamentarisches Gemeinwesen im Fluss der bundesrepublikanischen Geschichte nicht entfalten können.
Die wesentliche Erfolgsbedingung des Grundgesetzes aber war, ist und bleibt ein gefestigtes konstitutionelles Bewusstsein oder: der „Wille zur Verfassung“ (Peter Lerche) – bei den Verfassungsorganen und ihren politischen Funktionsträgern ebenso wie bei den freien Bürger und ihren Assoziationen.
PUBLICUS: Dennoch hat das Grundgesetz durch 67 Änderungsgesetze 237 Einzeländerungen erfahren. Von 122 geänderten Artikeln wurden 59 Artikel mehrfach geändert. Folgt dies aus der Notwendigkeit, eine Verfassung aktuell zu halten, oder wurde das Grundgesetz angesichts der Vielzahl der Änderungen nicht eher zur politischen Verfügungsmasse?
Horn: Das Vertrauen in das Grundgesetz hat auch mit seiner vielfach bewiesenen Fähigkeit zu tun, auf fortschreitende Entwicklungen der Verfassungswirklichkeit mit mitschreitenden Entwicklungen des Verfassungsgesetzes zu reagieren. Solche Änderungen erneuern den Wirklichkeitsbezug der Verfassung, ohne den sie ihre normative Funktion verfehlen würde.
Das markanteste Beispiel liefert die Umsetzung der deutschen Wiedervereinigung. Die Integration der ostdeutschen Länder in das Verfassungsgefüge des Grundgesetzes ist weithin gelungen, mag man dort auch bis heute manche höheren oder anderen Erwartungen nicht erfüllt sehen. Die Ersetzung des Beitrittsartikels durch den Auftrag zur Mitwirkung an der Europäischen Integration in Art. 23 GG war gerade in außenpolitischer Hinsicht von großer Symbolkraft.
Andererseits darf ein notwendiger Wirklichkeitsbezug nicht die normative Eigenart und den Selbststand des Verfassungsrechts untergraben. Mit erhöhten Verfahrenshürden und materiellen Grenzen für Verfassungsänderungen sucht das Grundgesetz seine Identität im Wandel zu bewahren, zumal von tagespolitischen Zugriffen und kleinteiligen Festschreibungen fernzuhalten. Ob das in der Vergangenheit durchweg gelungen ist, lässt sich in Anbetracht einzelner Novellierungen gewiss bezweifeln.
Verfassungsänderungen beruhen allerdings immer auf einem politischen Kompromiss zwischen verschiedensten Interessen, Wertungen und Grundvorstellungen. Auch insoweit kommt es daher auf ein hinreichendes konstitutionelles Bewusstsein an, das zwischen notwendiger Flexibilität und gebotener Rigidität die richtige Spur hält. Von einem Abgleiten des Grundgesetzes zur politischen Verfügungsmasse der Legislative, gleichsam das Weimarer Rechtsverständnis vor Augen, kann indessen glücklicherweise nicht die Rede sein.
PUBLICUS: Eine Verfassung soll nicht zuletzt, so eine landläufige Vorstellung, die Garantie von Grundrechten und Freiheiten „von der Agenda“ nehmen, um diese den Wechselfällen der tagespolitischen Opportunität zu entziehen. Vor dem Hintergrund auch der Bedrohung durch einen erstarkenden politischen Extremismus: Inwiefern wird das Grundgesetz dieser Funktion gerecht?
Horn: Man muss hier differenzieren zwischen dem, was das Grundgesetz der staatlichen, und dem, was es der gesellschaftlichen Willensbildung „von der Agenda“ nimmt: Was den Staat angeht, so sind selbst für den verfassungsändernden Gesetzgeber die Würde des Menschen und der Menschenwürdegehalt der Grundrechte unverfügbar. Sie zu achten und zu schützen, ist vielmehr Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Auch darf in keinem Fall der Wesensgehalt eines Grundrechts angetastet werden. Das Grundgesetz schützt so vor der Legalität eines politischen Extremismus, die den Einzelnen in seinem Wert- und Achtungsanspruch als freie, selbstbestimmte Person negiert und einer absoluten Gewalt oder diskriminierenden Ideologie unterwirft.
Für den Raum der gesellschaftlichen Begegnung bestimmt das Grundgesetz indessen das Prinzip der staatsfernen, prinzipiell unbegrenzten Freiheit der Bürger. Hier sind, wenn man so sagen will, Grundrechte und Freiheiten gerade „auf die Agenda“ gesetzt. Als Garantien einer offenen, pluralen Gesellschaft erwarten sie den vernünftigen, verantwortlichen und verträglichen Gebrauch der Freiheit, der seine Grenze erst dort findet, wo die Rechte anderer oder die allgemeinen Gesetze zur Ausgestaltung der verfassungsmäßigen Ordnung verletzt werden.
Demgemäß vertraut das Grundgesetz auch „in politicis“, wie das BVerfG immer wieder betont, grundsätzlich auf die Kraft der freien Auseinandersetzung der Meinungen, und zwar „als wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien“.
Wenn allerdings, wie schon Hannah Arendt im Jahre 1960 schrieb, die Bedrohung der Freiheit in der modernen Gesellschaft nicht vom Staat, sondern – wie zurzeit wieder – von der Gesellschaft kommt, dann wird der freiheitliche Staat unausweichlich mit der Frage konfrontiert, ob das „große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde), nicht eine „offene Flanke“ (Joachim Fest) bedeutet.
PUBLICUS: Die aktuelle politische Situation hat die Diskussion wieder entfacht: Sind die Instrumente, die das Grundgesetz unter dem vom BVerfG geprägten Begriff der „wehrhaften Demokratie“ zur Bekämpfung seiner Gegner bereithält, aus Ihrer Sicht ausreichend?
Horn: Die grundgesetzlichen Instrumente der „wehrhaften Demokratie“, wie insbesondere, aber nicht nur das Vereinsverbot, die Grundrechtsverwirkung, das Parteiverbot und neuerdings der Parteifinanzierungsausschluss, beruhen auf dem klaren verfassungspolitischen Willen, dass die freiheitliche demokratische Ordnung es nicht zulässt, die von ihr gewährleistete Freiheit der politischen Betätigung zum Kampf gegen diese Ordnung zu missbrauchen. Das Grundgesetz verwehrt den Feinden der Freiheit die Berufung auf ebendiese Freiheit, nicht als von außen gesetzte Beschränkung, sondern als immanente Bedingung einer dauerhaften freiheitlichen Demokratie. Weil zu dieser aber ganz wesentlich die Toleranz gegenüber allen politischen, auch verfassungsfeindlichen Auffassungen gehört, geht es hier um die „Lösung eines Grenzproblems der freiheitlichen demokratischen Staatsordnung“ (BVerfG).
Deshalb unterliegen die Instrumente, tatbestandlich wie verfahrensmäßig, höchst qualifizierten Voraussetzungen und können nur von höchstrangiger Stelle verfügt werden, sehen dann aber in der Rechtsfolge auch nur eine einzige, äußerst gravierende Sanktion vor: Der bislang frei, dabei aber erwiesen planvoll gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung agierende Verfassungsfeind wird für die Zukunft aus dem grundrechtlich geschützten Prozess der politischen Willensbildung ausgeschlossen.
Die Wehrhaftigkeit der freiheitlichen Demokratie setzt zwar nicht erst ab dieser Schwelle ein. Die präventiven Beobachtungsbefugnisse des Verfassungsschutzes, die repressiven Staatsschutznormen des Strafrechts und die daran anknüpfenden Möglichkeiten des Gefahrenabwehrrechts treten flankierend und ergänzend hinzu. Doch wird sich angesichts des aus den verschiedensten Ecken der Republik anschwellenden politischen Extremismus die Frage stellen, ob damit der Regelungsspielraum des Gesetzgebers im Vorfeld jener verfassungsrechtlichen Schutzinstrumente schon vollends ausgeschöpft ist, um gegenwärtigen Kampfansagen gegen die Grundwerte und Grundprinzipien der freiheitlichen Demokratie entgegenzuwirken. Mit der gleichen Wachsamkeit für das Prinzip Freiheit gilt es aber auch sozialtechnologische Wirkungsabsichten öffentlich-rechtlicher oder privater Akteure daraufhin zu befragen, inwieweit sie von einem semi-liberal-demokratischen Impetus getragen sind.
PUBLICUS: Sind trotz der Vielzahl der Änderungen weitere Anpassungen erforderlich – und wenn ja: Welche?
Horn: Eingedenk der oben angesprochenen Grundordnungsfunktion der Verfassung sollte das verfassungspolitische Räsonieren über weitere Grundgesetzänderungen grundsätzlich von Zurückhaltung getragen sein. Andererseits ist es gerade diese Grundordnungsfunktion, zu deren auch zukünftiger Sicherung Erwägungen über punktuelle Anpassungs- im Sinne von Aktualisierungs- und Modernisierungsbedarfe in Betracht gezogen werden können. Ich denke dabei z. B. an Themen wie die Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane für die Demokratie in Europa (Art. 23 GG), die Justierung des Rechts der Staatsverschuldung und der Mitwirkung an EU-Verschuldungen (Art. 109, 115 GG), die Organisation der Rüstungsgüterbeschaffung (Art. 87b GG), das Modell des Bundestagswahlsystems (Art. 38) oder gewiss auch die Grundstrukturen der Bundesverfassungsgerichtsbarkeit (Art. 93, 94 GG).
PUBLICUS: Wie stehen Sie z. B. zu einer Einschränkung des Streikrechts im Bereich der Daseinsvorsorge?
Horn: Den angedeuteten Spannungslagen kann meines Erachtens im Wege der sachgerechten Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hinreichend Rechnung getragen werden. Verfassungsrechtlichen Änderungsbedarf (Art. 9 Abs. 3 GG) sehe ich hier nicht.
PUBLICUS: Was verbinden Sie mit dem von Dolf Sternberger geprägten Begriff des „Verfassungspatriotismus“, und halten Sie ihn für eine geeignete Kategorie, um auch heute noch angemessen über die Bestandsvoraussetzungen des demokratischen Verfassungsstaats zu sprechen?
Horn: Die unversöhnliche Frontstellung zu einem Nationalpatriotismus, in die der Begriff zu früheren Zeiten entgegen der Anlage seines Urhebers geraten war, ist längst einem Verständnis gewichen, nach dem auch der Verfassungspatriotismus, reduziert auf ein bloß zweckrationales Integrationskonzept, der emotionalen Unterlegung aus den historischen und kulturellen Identitätsressourcen einer zum Staat geeinten Gesellschaft bedarf. Will sie Rechts- und Wertegemeinschaft sein, handelt es sich notwendig um komplementäre Quellen (Komponenten) des politischen Zusammenhalts, die nicht unverbunden nebeneinander oder gar in Widerstreit zueinander stehen, sondern miteinander verwoben sind und voneinander zehren. Im Begriff des demokratischen Verfassungsstaates „als kulturelle Leistung“ (Peter Häberle) erscheint jede Polarität ohnehin aufgehoben. So baut auch das Grundgesetz gleichermaßen auf die Voraussetzung wie auf die Erwartung, dass die Bürger die allgemeinen Werte der Verfassung akzeptieren und „leben“, sie sich zumal in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung einander als Freie und Gleiche erkennen und respektieren, sich dann aber auch in der Versinnbildlichung und Verteidigung dieser Werte als politische Solidar- oder Schicksalsgemeinschaft empfinden und wahrnehmen.
Erkennt man also in der Verbindung von (nationalem) Patriotismus und (nationaler) Verfassung eine politische Kategorie, die beides nicht gegeneinander, sondern miteinander denkt, dann kann die derart rekonstruierte Formel vom Verfassungspatriotismus auch heute, in Zeiten multipler Herausforderungen, als angemessene, in ihrer normativen Intentionalität aber eben auch anspruchsvolle Beschreibung dessen dienen, was den demokratischen Verfassungsstaat des Grundgesetzes substanziell ausmacht.
PUBLICUS: Aus Artikel 140 des Grundgesetzes sowie den Bezugnahmen auf die Weimarer Verfassung ergibt sich das Verbot der Staatskirche sowie die institutionelle Trennung von Staat und Kirche. Von den neun bundesweiten Feiertagen in Deutschland sind lediglich drei Feiertage ohne religiösen Bezug. Wird damit der Trennung von Staat und Kirche angemessen Rechnung getragen?
Horn: Im Horizont der vorangegangenen Frage drängt sich die Gegenfrage geradezu auf: Bröckelt der Verfassungspatriotismus, steht das Religionsverfassungsrecht im Blick? Das Grundgesetz hat sich mit der Übernahme der staatskirchenrechtlichen Artikel aus der Weimarer Verfassung gegen einen strikten Laizismus, stattdessen für eine sogenannte hinkende Trennung von Staat und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften entschieden. Das für partielle Kooperation offene Modell anerkennt die Religionsgesellschaften als integrierende Potenzen des staatlichen Gemeinschaftslebens. Das schließt – unbeschadet der grundsätzlichen weltanschaulichen Neutralität des Staates, vielmehr als Ausdruck der historisch gewachsenen kulturellen Identität des individuellen Gemeinwesens – den staatlichen Schutz der von den Kirchen festgesetzten Feiertage mit ein. Allerdings steht ihre staatliche Anerkennung im Ermessen des Gesetzgebers. Ob und inwieweit ihr Umfang noch der gegenwärtig lebendigen Bedeutung entspricht, ist also Gegenstand des demokratischen Prozesses.
PUBLICUS: Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, den 23. Mai zum bundesweiten Feiertag zu erklären und auf einen der kirchlichen Feiertage zu verzichten?
Horn: Die zum 75. Verfassungsjubiläum wieder aufgenommene, aber auch wieder ins Stocken geratene Idee scheint mir im Dienste einer integrierenden Selbstvergewisserung und eines alle Bürgerinnen und Bürger einladenden Nationalerlebnisses weiterhin erwägenswert. Dann aber wohl als Feiertag, nicht als „Gedenktag“. Ein Junktim mit der Streichung eines kirchlichen Feiertages sehe ich allerdings nicht. Zu bedenken mag freilich sein, dass der Feiertag mit der Polemik belastet werden könnte, welches Grundgesetz eigentlich gefeiert werden soll. Hier lauern auch Gefahren öffentlicher Delegitimierung.
PUBLICUS: Sollte das Grundgesetz – nach lange vollzogener Herstellung der Deutschen Einheit – den Titel „Verfassung“ bekommen?
Horn: Nein. Das „Grundgesetz“ war und ist eine Vollverfassung. Der Name – auch in seiner weniger markant anmutenden Übersetzung als „Basic Law“ oder „Loi fondamentale“ – steht nach innen wie nach außen für eine eigensinnige und selbstbewusste politische Identität.
PUBLICUS: Zu guter Letzt: Was wünschen Sie dem Grundgesetz zum 75. Geburtstag?
Horn: Alles Gute und ein langes Leben, insbesondere bürgerlichen Respekt und staatlichen Schutz, normative Kraft im Wirken der politischen Leitungsorgane, gedeihliche Pflege unter dem Wächteramt weiser Bundesverfassungsrichter, Bewährung und Behauptung im europäischen Verfassungsverbund, einheitsstiftende Loyalität in Zeiten fragmentierter Öffentlichkeit, Wehrhaftigkeit gegen politischen Extremismus und Autoritarismus, kluge Offenheit für gesellschaftliche Erwartungen, aber Standhaftigkeit gegen Anfechtungen eines „populist constitutional law“.
Zur Person:
 Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Detlef Horn ist seit Oktober 1999 Inhaber einer Professur für Öffentliches Recht am Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Sein Arbeitsspektrum in Forschung und Lehre umfasst das Staats- und Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht, das Europarecht sowie das Wirtschaftsvölkerrecht. Von 2003 bis 2010 war er im zweiten Hauptamt Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Detlef Horn ist seit Oktober 1999 Inhaber einer Professur für Öffentliches Recht am Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Sein Arbeitsspektrum in Forschung und Lehre umfasst das Staats- und Verfassungsrecht, das Verwaltungsrecht, das Europarecht sowie das Wirtschaftsvölkerrecht. Von 2003 bis 2010 war er im zweiten Hauptamt Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.
Die Serie: 75. Jubiläum des Grundgesetzes