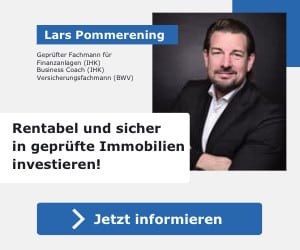Heute, im Jahre 2024, sind einige bemerkenswerte Ereignisse genau 50 Jahre her. Der Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1974 etwa: Die Bundesrepublik Deutschland gewann das Turnier mit einem 2:1-Sieg über die Niederlande im Finale von München und wurde damit zum zweiten Mal nach 1954 Weltmeister. Auch hier in Flensburg gab es ein kommunales Ereignis, das jedoch längst nicht die große Beachtung wie der gewonnene Fußball-WM-Titel fand.
Eine (fast) vergessene Gebietsreform
Der Kreis Flensburg-Land war ein Landkreis in Schleswig-Holstein, der immerhin 107 Jahre lang Bestand hatte. Im Jahr 1974 wurde er mit dem Nachbarkreis Schleswig zum neuen Landkreis Schleswig-Flensburg zusammengefasst. Der Kreis lag im Nordosten Schleswig-Holsteins um Flensburg herum, grenzte Anfang 1974 im Westen an den Kreis Nordfriesland, im Süden an den Kreis Schleswig, im Osten an die Ostsee, im Norden an Dänemark. Er hatte seinen Verwaltungssitz in der Flensburger Waitzstraße Nr. 1-3 im sogenannten Kreishaus, eigentlich ein Gebäude-Ensemble, bestehend aus dem ehemaligen Amtsverwalterwohnhaus aus dem 18. Jahrhundert und dem neuen Amtshaus aus dem 19. Jahrhundert. Die Kreisstadt Flensburg gehörte dem Kreis übrigens ab 1889 nicht mehr an – sie ist heute eine sogenannte kreisfreie Stadt. Im Jahr 1973 wurde im Kieler Landtag mit dem „Dritten Gesetz einer Neuordnung von Gemeinde- und Kreisgrenzen“ die Zusammenlegung des Kreises Flensburg-Land und des Kreises Schleswig beschlossen. Am 24. März 1974, dem Tag der Kommunalwahl, wurden die beiden Kreise Flensburg-Land und Schleswig zum neuen Kreis Schleswig-Flensburg vereinigt. Dieser Tag jährte sich erst neulich zum 50. Mal. Der Gebäudekomplex in der Waitzstraße wurde anschließend von der Gewoba Nord zur weiteren Verwendung übernommen.

Hans-Wilhelm, ein „Flensburger Jung“
Der kleine Hans-Wilhelm erblickte am 25. November 1930 das Licht der Welt – „to Huus“ (zu Hause), wie es damals durchaus üblich war. Die Geburt fand im Flensburger Stadtteil Duburg statt. Die Familie Langholz, sprich: Vater, Mutter und die fünfjährige Tochter Irene, wohnte zu jener Zeit in der Knappenstraße 4, an der Ecke zur Bergstraße. Nun waren sie zu viert, es musste eine größere Wohnung her. Die fanden sie schließlich in der Nähe des Hafermarktes, im unteren Teil der Glücksburger Straße im Haus Nr. 12. Im Frühjahr 1937 wurde Hans-Wilhelm eingeschult in die nahe gelegene St.-Jürgen-Schule, damals hieß sie Langemarck-Schule (benannt nach einem Nazi-Mythos), später wurde sie die Willi-Weber-Schule. An dieser Volksschule machte er im März 1945 seinen Schulabschluss und wechselte umgehend in die Berufsausbildung.
Eine Lehre in außergewöhnlichen Zeiten
Hans-Wilhelm begann am 1. April 1945 eine Verwaltungslehre im damaligen Landratsamt des Kreises Flensburg-Land, in der Waitzstraße Nr. 1 bis 3. Er hatte von der Glücksburger Straße kommend einen sehr kurzen (Fuß)-Weg zur Arbeit. Der Zweite Weltkrieg befand sich im letzten Stadium, große Teile der Welt und auch Deutschlands lagen in Trümmern, viele hochrangige Soldaten und Zivilisten des NS-Regimes trafen sich auf ihrer Flucht in Flensburg, dem letzten noch nicht besetzten Zipfel Deutschlands.
Da nicht alle Dienststellen und Behörden der Regierung Dönitz Unterschlupf in der Marineschule in Mürwik finden konnten, soviel Platz war dort einfach nicht vorhanden, wichen sie nach Langholz Erinnerungen auf andere Unterkünfte im Flensburger Stadtgebiet aus. Ins Landratsamt zogen bis zur Kapitulation unter anderem der Reichsgesundheitsführer Dr. Conti und Teile des Innenministeriums ein. „Der Landrat musste sogar für die Leute aus Berlin sein Dienstzimmer räumen“, hat Langholz die Ereignisse noch genau vor Augen. „Es ging zu wie in einem Bienenstock, doch bis Ende Mai 1945 war dann dieser Spuk endgültig vorbei, die meisten „hohen Tiere“ waren verhaftet, die anderen Mitarbeiter einfach verschwunden!“
Die englische Besatzungsmacht übernahm unverzüglich das Behördengebäude und richtete im unteren Bereich Räumlichkeiten für ihre Militärregierung ein. Das Landratsamt verblieb in den übrigen Räumen des Gebäudekomplexes, man hatte ja immerhin 132 Gemeinden im Kreis Flensburg – von Ahneby bis Wittkiel – zu betreuen. Im Hof des Hauses Nr. 5 war die Gendarmerie des Kreises stationiert, im Hause dagegen befand sich die Dienstwohnung des Landrats. Einige Dienststellen des Landratsamts waren vorübergehend anderweitig in Flensburg untergebracht, so unter anderem das Ernährungsamt unter den Kolonnaden am Südermarkt, das Wohlfahrtsamt und das Jugendamt in der ehemaligen Eisfabrik (später das Flensburger Arbeitsamt) in der Straße Munketoft. Die Kfz-Stelle kam vorübergehend bei den Flensburger Stadtwerken unter.
Hans-Wilhelm durchlief während seiner dreijährigen Lehrzeit alle Abteilungen der Kommunalverwaltung des Kreises Flensburg, bis er nach bestandener Prüfung mit dem Datum des 31. März 1948 aus dem Status „Verwaltungslehrling“ ausschied. Von den seinerzeit insgesamt 12 Lehrlingen wurden jedoch nur er und ein weiterer Lehrling in ein weiterführendes Angestelltenverhältnis im gleichen Hause übernommen. Nach einem halbjährlichen und erfolgreichen Besuch der Sparkassen- und Verwaltungsakademie in Kiel Anfang 1955 wurde Hans-Wilhelm später im Jahr 1955 ins Beamtenverhältnis übernommen.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre
War der kleine Hans-Wilhelm anfangs noch stolz, in kurzer Hose und strammer Hitlerjugend-Uniform für den Reichsgesundheitsführer dessen Büro aufräumen und fegen zu dürfen, sollten bald ganz andere Aufgaben auf ihn zukommen. Nach der Übernahme durch die englische Militärverwaltung durchlief er die gewöhnliche Ausbildung in allen unterschiedlichen Sachgebieten, hatte jedoch auch noch Sonderaufgaben zu erfüllen. Bereits seit Januar 1945 waren in ganz Deutschland gewaltige Flüchtlingsströme unterwegs, die meisten davon in Richtung Norden. So kamen täglich zahlreiche Züge auf dem Flensburger Bahnhof an, aus denen unzählige Menschen aus den deutschen Ostgebieten quollen.
Hans-Wilhelm und einige andere Lehrlinge wurden am Bahnhof als Kofferträger und Einweiser für die Ankömmlinge eingesetzt, geleiteten die Menschen zu den bereitstehenden Bussen, die die Flüchtlinge zu den umliegenden Ortschaften und 132 Gemeinden des Kreises transportieren sollten. Dem damaligen Leiter des Wohnungsamtes, Hanni Maaß, und seiner Mitarbeiterin Luise Jodies oblag auch die Aufgabe, die vielen Flüchtlinge im Kreisgebiet unterzubringen und auf die Gemeinden zu verteilen – eine wahre Mammutaufgabe, die aber geleistet werden musste.
Kai-Uwe von Hassel übernahm dann diese Tätigkeit, nachdem er Ende 1945 aus britischer Kriegsgefangenschaft nach Schleswig-Holstein zurückkehrte und gleich nach erfolgter Rückkehr beim Landkreis Flensburg als Beauftragter für Wohnungs- und Flüchtlingsangelegenheiten eingesetzt und verantwortlich war.
Von Hassel machte eine rasante Karriere in der jungen Bundesrepublik: 1946 trat er in die neu gegründete CDU ein, wurde 1947 Bürgermeister von Glücksburg. Nebenbei vom Landrat Friedrich-Wilhelm Lübke (1887-1954) gefördert, zog er 1950 als Abgeordneter in den Schleswig-Holsteinischen Landtag ein und rückte 1951 zum stellvertretenden Landesvorsitzenden hinter Lübke, dem nunmehrigen Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden der CDU, auf. Nach Lübkes Tod 1954 wurde von Hassel dessen Nachfolger in beiden Ämtern, weshalb er sein 1953 gewonnenes Bundestagsmandat aufgab. Später setzte er als Regierungschef Schleswig-Holsteins die Politik seines Vorgängers fort.
Von Hassel agierte in jenen turbulenten Jahren anfangs als sogenannter Schlichtungsbeamter im Landratsamt, war in dieser Funktion ständig mit seinem Auto, einem DKW, auf Tour – sein unverkennbares Markenzeichen war dabei sein großer Schlapphut. Es gab bei der riesigen Zahl von unterzubringenden Flüchtlingen naturgemäß den einen oder anderen Streit und Konflikt, den er aber meist gütlich zu schlichten wusste.
In den harten Wintern der Jahre 1946 und 1947, teilweise sogar noch bis ins Jahr 1950 hinein, wurde von der Verwaltungsleitung den Mitarbeitern des Hauses im Rahmen einer persönlichen Selbstversorgung der Rohstoff „Torf“ zum Heizen angeboten.
Jung und Alt beteiligten sich gern an dieser Aktion. Die Teilnehmer mussten frühmorgens mit Schaufel und Spaten am Sammelpunkt antreten, von dort ging es im offenen LKW, mit Holzgas betrieben, voll besetzt in Richtung Jardelunder Moor zum Torfstechen. Nach getaner Arbeit und Feierabend „im Torf“ ging es wieder heim, man freute sich auf den Feierabend nach der ungewohnten und körperlichen schweren Arbeit. Die Belohnung war für jeden allerdings enorm: Jeder Teilnehmer erhielt als Dank am Ende einen LKW „voll mit Brennmaterial“ frei Haus. Das half allen Beschäftigten sehr, gut durch die kalte Winterzeit zu kommen. Frauen, Männer und sämtliche Lehrlinge haben gern mitgemacht. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein konnte, wurde dennoch ebenfalls mit einer Ladung Torf nach Hause beglückt. Solidarität wurde damals in den Jahren der Nachkriegszeit großgeschrieben. „Wir waren alle gleich, hatten alle gleich wenig“, weiß unser Protagonist zu erzählen.
Währungsreform
Am 20. Juni 1948 erfolgte eine Neuordnung des Geldwesens in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands, der späteren Bundesrepublik. Eine Währungsreform trat an jenem Tag in Kraft, und die „Deutsche Mark“ ersetzte ab dem 21. Juni 1948 die bis dahin gültigen Zahlungsmittel „Reichsmark“ und „Rentenmark“, die damit ungültig wurden.
Die Ausgabe des „Kopfgeldes“ erfolgte im ersten Schritt ab dem frühen Sonntagmorgen des 20. Juni 1948: An Einzelstehende bzw. Haushaltsvorstände in Höhe von 40 DM je Kopf (inflationsbereinigt etwa 122 € im Jahr 2024). Dabei sah das „Geldpaket“ in der Regel so aus: 1 Zwanzigmarkschein, 2 Fünfmarkscheine, 3 Zweimarkscheine, 2 Einmarkscheine und 4 Einhalbmarkscheine. Jeder natürlichen Person wurden einen Monat später 20 DM bar ausgezahlt. Bei der späteren Umwandlung von Reichsmark beispielsweise in Bankkonten wurden diese 60 DM angerechnet.
Unser Chronist Hans-Wilhelm Langholz begleitete einige Kollegen aus dem Amt, die mit dem Dienst-Bus unterwegs waren und die Geldpakete zu den Zahlstellen der 132 Gemeinden des Landkreises brachten, wo das Geld anschließend an die Bürger ausgezahlt wurde. Mit der Tätigkeit waren die Mitarbeiter eine ziemliche Zeit lang beschäftigt.

Aufgaben des Kreises Flensburg-Land
In der damaligen Zeit gab es noch die Flensburger Kreisbahn, die als ein Eigenbetrieb des Landkreises Flensburg die Region bediente. Sie erschloss die Region Angeln, führte über Glücksburg weiter über Dollerup und Rundhof bis zur Endstation in der Hafenstadt Kappeln, wohin später auch Strecken der Schleswiger und der Eckernförder Kreisbahnen geführt wurden. Diese Kleinbahn war seinerzeit die einzige Verbindung von Flensburg nach Kappeln (mit dem Bau der heutigen Nordstraße B199 wurde erst 1951 begonnen). Eine Fahrt von Endstation zu Endstation dauerte mehrere Stunden. Das nahmen dennoch viele Reisende damals in der „Reichsmarkzeit“ (vor 1949) gern in Kauf, fuhren sie doch oft zu den Eltern, Verwandten, Freunden oder Bekannten aufs Land, um sich anschließend zuhause mal wieder richtig satt zu essen und gleichzeitig ein sogenanntes Speckpaket für die Folgewoche mitzunehmen. „Gern erinnere ich mich noch an manches Stück Schmalzbrot, das uns die auswärtigen Kollegen von ihren Wochenendfahrten mitbrachten“, schmunzelt unser Chronist.
Nach der Stilllegung der Flensburger Kreisbahn am 31. März 1953 und gleichzeitiger Fertigstellung der Nordstraße erfolgte in den 50er Jahren die verkehrsmäßige Erschließung des Angelner Raumes. Ein umfangreiches „Dreijahres-Wegebau-Programm“ wurde dazu aufgelegt. Die Umsetzung dieses Planes erlebte Hans-Wilhelm hautnah mit, war er doch in dieser Zeit als (kleiner) Mitarbeiter in der Kommunalaufsicht des Kreises tätig. „Amtssprache in jenen Jahren war Platt-Deutsch“, weiß Langholz noch ganz genau. Tür an Tür zu dieser Abteilung residierte der damalige Landrat Dr. Hartwig Schlegelberger, von 1954 bis 1961 auf dem Posten eingesetzt. „Dr. Schlegelberger war übrigens ein Beamter durch und durch“, erinnert sich Hans-Wilhelm. „Im Jahre 1955, genauer gesagt, zu Pfingsten, sollte ich feierlich ins Beamtenverhältnis übernommen werden, wurde mir kurzfristig mitgeteilt. Für das Pfingstfest hatte ich allerdings schon mit einigen Freunden eine Campingtour mit Zelt und Fahrrad nach Dänemark geplant. Als ich den Landrat zu fragen wagte, ob wir das feierliche Aushändigen der Urkunde nicht auf einen Zeitpunkt nach dem Dänemark-Trip verlegen könnten, blickte er mich kurz mit seinem strengen Blick an und meinte ganz humorlos: „Langholz, wollen Sie nun Beamter werden oder lieber in Urlaub fahren?“
Und Hans-Wilhelm ergänzt: „So kam es, dass mir und einigen anderen Kollegen die Urkunde der Übernahme in das Beamtenverhältnis feierlich an dem besagten Pfingstsonnabend im Amtssaal des Hauses überreicht wurde.“
Sein damaliger Abteilungsleiter Theo Tramm in der Kommunalaufsicht schlug Langholz später als seinen Nachfolger vor, unterstützte und förderte ihn auch in anderer Weise: Er sorgte dafür, dass Langholz und seine frisch gegründete Familie als Nachmieter ins Amtshaus des damaligen Amtes Adelby einziehen konnte. Überhaupt waren die Kollegialität und der Zusammenhalt der Beschäftigten im Landratsamt damals ausgesprochen gut. Man arbeitete Hand in Hand, feierte gemeinsam rauschende Betriebsfeste, und unterstützte sich selbstverständlich auch gegenseitig in der Freizeit.
Hatte ein Mitarbeiter ein besonderes familiäres Ereignis wie Hochzeit, runder Geburtstag usw. zu feiern, wurde ihm oder ihr regelmäßig eine große Glückwunschkarte überreicht, auf der sämtliche rund 80 Mitarbeiter des Amtes unterschrieben hatten – für die Unterschrift des Landrats wurde stets am Kopf der Karte ein Feld freigehalten. Das zeigte deutlich auf, dass es seinerzeit ein tolles Miteinander in der Behörde gab. Alle Kollegen besaßen wenig bis fast nichts, waren aber auf der anderen Seite auch froh und glücklich, eine feste Anstellung im öffentlichen Dienst zu haben.
Der junge Beamte Langholz wird erwachsen
Eine eigene Wohnung hätte er sich anfangs von seinem Gehalt nicht leisten können. Es sollte noch bis zum August 1958 dauern, bis Hans-Wilhelm die elterliche Wohnung verlassen konnte. Da war er allerdings schon mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt bezogen Hans-Wilhelm und Ehefrau Lisa ihre erste eigene kleine Wohnung im Angelsunder Weg. Dort blieben sie wohnen, bis sich 1963 die Gelegenheit bot, wie erwähnt ins Amtshaus des Amtes Adelby einzuziehen – damals am Anfang des Sünderuper Wegs gelegen. Über den Amtsräumen gab es unterm Dach eine kleine gemütliche Wohnung, die fortan ihr Zuhause war. In dieser Gegend fühlte er sich längst zu Hause, er hatte ja bereits 1956 seine Lisa geheiratet, zudem war der Weg zu seinem Sportverein SV Adelby ebenfalls nicht weit, wie auch der Weg zur Arbeit „unten“ in der Waitzstraße.
Einige Jahre später wurde der südlicher gelegene Teil des Sünderuper Wegs als Baugebiet ausgewiesen, Hans-Wilhelm und Frau erwarben dort ein Grundstück – die spätere Hausnummer 38 – und bauten ihr eigenes schmuckes Haus. Die allmähliche Entstehung des Eigenheims im Sünderuper Weg 38 vom Sommer bis zum Einzug im Dezember 1969 begleiteten tatkräftig viele Freunde, zahlreiche Arbeitskollegen und Sportkameraden. Auf der Baustelle war immer etwas los. Insgesamt dauerte es vom ersten Spatenstich bis zur endgültigen Fertigstellung etwa fünf Monate. Das große Zusammengehörigkeitsgefühl zeigte sich besonders am Tag des Richtfestes, am 5. September 1969, als 110 Leute dabei waren und tatkräftig mitfeierten – bis etwa 3 Uhr morgens.

Letztes großes Bauvorhaben des Kreises Flensburg-Land
Anfang der 1970er Jahre wurde im Auftrag des Kreises das DRK-Pflegezentrum Glücksburg geplant und gebaut.
Dieses schöne Alten- und Pflegeheim in Glücksburg an der Ostsee ist heute das Zuhause von 100 Bewohnerinnen und Bewohnern. Es beeindruckt durch seine tolle, zentrale Lage und liegt als parkähnliches Grundstück mitten im Grünen. Kirche, Ärzte und der Marktplatz mit besten Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in direkter Nachbarschaft. Das Wasserschloss Glücksburg ist nur wenige hundert Meter entfernt. Zur feierlichen Einweihung des Hauses gaben sich viele Honoratioren die Ehre. Die Mitarbeiter des Landratsamtes wurden als Helfer und Unterstützer bei dem Ereignis eingesetzt, Hans-Wilhelm durfte beim Bedienen der Gäste unterstützen und bekam anschließend sogar von der Gattin des Landrats Dr. Schlegelberger ein feines Lob zu hören: „Langholz, Sie haben einen guten Eindruck hinterlassen!“
Anekdote am Rande
Hans-Wilhelm war viele Jahre lang mit dem SV Adelby auf dem Scheersberg zu Gast. Dort fungierte er 12 Jahre lang als Starter bei den Leichtathletik-Wettbewerben. Selbstredend war er auch beim 50. Scheersbergfest 1984 als Teilnehmer am Start. Dort traf er zufällig den ehemaligen Ministerpräsidenten Dr. Kai-Uwe von Hassel, den er ja bereits aus seiner Lehrlingszeit aus dem Landratsamt kannte. Und der bekannte Politiker erkannte ihn gleich wieder: „Das ist ja der kleine Langholz, was machen Sie denn hier?“ Von Hassel war übrigens der einzige Vorgesetzte, der seinerzeit im Landratsamt die Lehrlinge siezte!

Dienststellenwechsel
Hans-Wilhelm gefiel die abwechslungsreiche Tätigkeit im Landratsamt durchaus, doch er war gleichzeitig auch offen für einen möglichen Dienststellenwechsel – dabei wollte er jedoch aus persönlichen Gründen gern im Nahbereich verbleiben. Sein langjähriger Freund und Kollege Hans-Werner Iversen „baggerte“ schon jahrelang daran, seinen Freund Langholz nach Harrislee in die dortige Verwaltung zu lotsen, weil er genau um dessen Fähigkeiten als Mensch und umsichtiger Verwaltungsbeamter wusste. Im Jahr 1970 waren seine Bemühungen endlich erfolgreich, und Hans-Wilhelm Langholz folgte seinem Lockruf. Zum 1. Januar 1971 trat er seinen Dienst bei der Gemeinde Harrislee an, der er über 23 Jahre treu dienen sollte. Im August 1993 wurde Langholz in den Ruhestand versetzt, schied zum 1. September 1993 im Alter von 63 Jahren aus dem Berufsleben aus.
Der damalige Harrisleer Bürgermeister Dr. Buschmann würdigte den allseits geschätzten Kollegen als ein Multitalent, dessen große Stärke der Umgang mit Menschen gewesen sei: „Wie kein anderer haben Sie als langjähriger Leiter des Sozialamtes dieser Gemeinde dazu beigetragen, dass das Bürgerhaus seiner Bestimmung als Anlaufstelle für rat- und hilfesuchende Bürger gerecht wurde. Sie haben den Hilfesuchenden nie das Gefühl gegeben, Menschen zweiter Klasse oder Bittsteller zu sein, sondern ihnen stets bei der Bewältigung ihrer Sorgen geholfen mit Rat und Tat!“
Nach Versetzung in den Ruhestand begann Hans-Wilhelm Langholz alsbald, seine Hobbies zu intensivieren. Er brachte zahlreiche Bücher, meist Fotobücher, heraus. Daneben zeichnete er für viele groß- und kleinformatige Kalender aus der Region verantwortlich, so unter anderem den bekannten Regionalkalender „Bi uns to Huus“.
Mit Hans-Wilhelm Langholz sprach Peter Feuerschütz
Fotos: Benjamin Nolte, privat