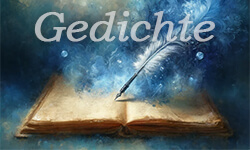
Gedichte als sprachliche Ausdrucksform werden bereits seit langem innerhalb der Linguistik erforscht und sind daher unentbehrlicher Bestandteil unserer Literatur. Sie sind bei vielen Menschen ziemlich beliebt, weil man sie singen, rhythmisch aufsagen, auswendig lernen oder auch selbst erfinden kann. Sie bieten viel Inhalt in wenigen Worten und bieten so Raum zur kreativen Entfaltung an.
Definition: Gedichte
Bei einem Gedicht handelt es sich um eine bestimmte Art von Text, welcher Gefühle und Gedanken ausdrückt. Man schreibt es meist in kurzen Zeilen, den Versen. Mehrere Verse bilden eine Strophe. Viele Gedichte haben mehrere Strophen.
Mit dem Begriff „Gedicht“ wurde ursprünglich alles schriftlich Abgefasste bezeichnet; in dem Wort „Dichtung“ hat sich noch etwas von dieser Bedeutung erhalten. Seit etwa dem 17. Jahrhundert wird der Begriff im heutigen Sinn nur noch für poetische Texte verwendet, die zur Gattung der Lyrik gehören.
Lyrik
Der Begriff „Lyrik“ leitet sich vom griechischen Ausdruck „lyra“ oder „lykrós“ ab. Ursprünglich meint der Begriff Gesänge, die in früherer Zeit mit dem Musikinstrument Lyra begleitet wurden.
Im Alltagssprachgebrauch bezeichnet „Lyrik“ eine literarische Gattung — meist im Gegensatz zu „Epik“ und „Dramatik“ — und „Gedicht“ einen Text, der zu dieser Gattung zählt, also einen „lyrischen“ Text. Grob gesagt, versteht man unter Lyrik also alles, was in Gedichtform geschrieben ist.
Das Attribut „lyrisch“ benutzt man aber auch in einem weiteren Sinne. So sprechen wir außerhalb der Literatur von einem „lyrischen Tenor“ (das ist ein Tenor mit weicher, für gefühlsbetonten Gesang besonders geeigneter Stimme).
Eine „lyrische Stimmung“ kann sich auch außerhalb des Kunstbereichs, beispielsweise in einer idyllischen Naturumgebung, einstellen. In diesem weiten Sinne bedeutet lyrisch „stimmungsvoll“ oder „gefühlsbetont“. Selbstverständlich finden sich ›lyrische Stimmungen‹ auch in Gedichten.
Merkmale
Gedichte sind eine faszinierende Kunstform, die durch verschiedene Merkmale geprägt sind. Sie kennzeichnen sich sowohl durch ihren Aufbau als auch durch die verwendete Sprache.
Im Folgenden wollen wir uns die einzelnen Aspekte beider Kriterien genauer anschauen.
1. Aufbau und Struktur
Verse und Strophen
Ein Gedicht besteht aus einzelnen Zeilen, die als Verse bezeichnet werden. Diese Verse sind wie Bausteine, die zusammengesetzt werden, damit das Gedicht entsteht. Mehrere Verse ergeben dann eine Strophe.
Strophen helfen dabei, das Gedicht in Abschnitte zu unterteilen und es so übersichtlicher zu gestalten. Sie beeinflussen auch, wie das Gedicht aussieht und wie es betont wird.
Noch weiter heruntergebrochen unterscheidet man zwischen Versfuß, Versmaß und Strophenform.
Reime
Die Endwörter in Gedichtversen reimen sich oft miteinander. Ein Reim kann durch die Ähnlichkeit der Laute nach dem letzten betonten Vokal erkannt werden. Die Anordnung dieser Reime folgt einem bestimmten Reimschema, zu denen Paarreime, Kreuzreime oder umarmende Reime gehören.
Zudem können Reime in ihrer Akustik unterschieden werden:
- Vollreim: Zwei Wörter haben eine ähnliche Schreibweise und den gleichen Klang.
- Unreiner Reim: Zwei Wörter klingen unterschiedlich, es reimen sich nur die Silben ähnlich
Betonung
In der Lyrik spielt die Betonung eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Rhythmus und Melodie in einem Gedicht. Der sprachliche Rhythmus wird durch das Metrum bestimmt. Dieses wiederum, auch als Versmaß bezeichnet, beschreibt die Sequenz an betonten und unbetonten Silben in einem Vers. Dies beeinflusst maßgeblich die Gestaltung der Struktur und des Tempos des Gedichts.
Zudem ist die Kadenz ein wesentlicher Faktor: Ein Text mit hauptsächlich männlicher Kadenz, könnte als konsequent und endgültig betrachtet werden, während ein Text mit vorwiegend weiblicher Kadenz als kontinuierlich und behutsam ausgelegt werden kann.
Dennoch findest du auch Gedichte, die nicht notwendigerweise an den Reim oder eine rhythmische Gestaltung gebunden sind. Früher galten Gedichte erst als solche, wenn sie in Vers- und Reimform geschrieben waren.
Aber: Moderne Gedichte weichen oft von der Norm ab. Beim „Poetry-Slam“ beispielsweise folgen die Texte meist nicht dem strikten Aufbau klassischer Gedichte, sondern verändern oft die Spielregeln durch die Verwendung verschiedener rhethorischer Mittel oder durch eine Kombination von freien Versen, Reimen und Rhythmen.
2. Inhalt und Sprache
Sprachliche Mittel
Neben den äußeren Eigenschaften, die den Aufbau und Struktur in Gedichten bestimmen, spielen inhaltliche Elemente ebenfalls eine wichtige Rolle: Sprachliche Mittel, auch genannte Stilmittel, werden häufig in Gedichten verwendet, um bestimmte Textstellen eingehend zu veranschaulichen.
Hier siehst du vier Beispiele für sprachliche Mittel, die besonders oft in Gedichten vorkommen:
Aufeinanderfolgende Wörter beginnen mit dem gleichen Anfangslaut.
Wiederholung des gleichen Wortes am Anfang von Sätzen oder Satzteilen.
Bildhafte Ausdrucksweise, bei der ein Begriff im übertragenen Sinn verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Dingen herzustellen.
Zuschreibung menschlicher Eigenschaften an nichtmenschliche Objekte.
Frage, die gestellt wird, um einen Effekt zu erzielen, ohne tatsächlich eine Antwort zu erwarten.
Lyrisches Ich
In lyrischen Texten ist das „lyrische Ich“ bzw. der lyrische Sprecher ein wichtiges Charakteristikum. Durch diese Form werden Erfahrungen, Gefühle und Gedanken des lyrischen Ichs an den Leser vermittelt. Es spricht hierbei, wie der Name schon sagt, aus der Ich-Perspektive.
In Gedichten können mehrere lyrische Ichs auftreten, was durch den Titel, der möglicherweise einen Namen nennt, oder durch den Text selbst erkennbar ist, wie z. B. in Goethes Gedicht „Prometheus“. Die Rolle des lyrischen Ichs kann explizit oder implizit sein.
Das explizite Ich zeigt persönliche Eindrücke deutlich, während das implizite Ich repräsentativ für eine Gruppe steht und seine Eindrücke weniger direkt übermittelt. So liegt es am Leser selbst, diese Unterscheidung zu erkennen und zu interpretieren.
Wichtig: Das lyrische Ich und der Autor sind nicht identisch. Es handelt sich um zwei verschiedene Personen, welche getrennt voneinander zu betrachten sind. Obwohl manchmal autobiografische Elemente in Gedichten zu finden sind, die eine Verbindung zum Autor herstellen könnten, fungiert das lyrische Ich in der Regel als Vermittler und repräsentiert eher eine Rolle oder Perspektive.
Formen
Ballade
- Oft in Strophenform verfasst
- Erzählungen in Gedichtform
- Bestehen manchmal aus Reimen, aber nicht zwingend
Elegie
- Oft in freiem Vers geschrieben
- Drückt oft eine traurige oder melancholische Stimmung aus
- Thematisiert dramatische Situationen wie z. B. Tod und Verlust
Epigramm
- Kurzes Gedicht, häufig nur einige Zeilen lang
- Enthält meist einen prägnanten Ausdruck
- Oft humorvoll, scharfsinnig und teilweise ironisch
Haiku
- Traditionell japanische Gedichtform
- Bestehend aus drei Zeilen mit je 5, 7 und 5 Silben
- Behandeln oft Themen der Natur
Ode
- Feste Gliederung in den Strophen
- Kein festes Reimmuster
- Feierlicher Sprachstil und theatralische Betonung
Sonett
- Gedicht mit 14 Zeilen
- Meist in zwei Vierzeiler und zwei Dreizeiler aufgeteilt
- Meist im Reimschema „abba abba“
Bekannte Werke der deutschen Literatur
Die Lyrik hat sich in der Literaturgeschichte Deutschlands ständig verändert und sich stets an die jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst.
Wird ein lyrisches Werk nicht nur einzeln betrachtet, sondern auch der geschichtliche Hintergrund dazu berücksichtigt, ist man viel mehr in der Lage, die Thematik des Textes einzuordnen und Motive zu interpretieren.
Eine Literaturepoche ist als zeitlicher Abschnitt in der Geschichte zu sehen, wobei die Übergänge zwischen den Epochen fließend sein können. Nachfolgend findest du einige Merkmale und bekannte Dichter mit einem stellvertretenden Werk für die jeweilige Epoche.
Mittelalter
- Geprägt von religiöser Weltanschauung und feudaler Gesellschaftsstruktur
- Dominanz der Kirche in Kunst und Kultur
- Blütezeit der höfischen Dichtung und Minnekunst
Barock
- Geprägt von Kontrasten zwischen Vergänglichkeit und Prachtentfaltung
- Betonung von Widersprüchen und Spannungen in der Welt
- Verwendung von Symbolik und Allegorie
Sturm und Drang
- Betonung der Individualität und der Naturverbundenheit
- Auflehnung gegen gesellschaftliche Konventionen und Vernunftprinzipien
- Betonung von Emotionen, Leidenschaft und Spontaneität
Weimarer Klassik
- Streben nach Harmonie zwischen Mensch und Natur
- Betonung von klassischen Idealen wie Maß, Ordnung und Ausgewogenheit
- Entwicklung einer humanistischen Bildungsideologie
Romantik
- Betonung von Individualität, Emotionen und Fantasie
- Sehnsucht nach Unendlichkeit, Naturverbundenheit und Mystik
- Faszination für das Irrationale und das Übernatürliche
Biedermeier
- Rückzug ins Private und Idyllische angesichts politischer und sozialer Unruhen
- Betonung von Familie, Heimat und bürgerlichem Wohlstand
- Idealisierung des Alltagslebens und der häuslichen Geborgenheit
Vormärz & Realismus
- Kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Missständen und politischen Entwicklungen
- Betonung von Alltagsrealismus und sozialer Wirklichkeit
- Aufkommen des bürgerlichen Realismus in Kunst und Literatur
Naturalismus
- Betonung von objektiver Wirklichkeitsdarstellung und sozialer Determination
- Darstellung der menschlichen Existenz als Ergebnis von biologischen und sozialen Faktoren
- Verwendung experimenteller Erzähltechniken und psychologischer Analyse
Expressionismus
- Betonung von subjektiver Wahrnehmung und Ausdruck
- Kritik an der Zivilisation und Suche nach innerer Wahrheit
- Verwendung von verstörenden Bildern und abstrakten Formen
Neue Sachlichkeit
- Nüchterne Darstellung der Realität und Ablehnung romantischer Verklärung
- Kritik an gesellschaftlichen Missständen und politischer Radikalisierung
- Betonung von Objektivität und Präzision in der Darstellung
Exilliteratur
- Reaktion auf den Ersten Weltkrieg und die Folgen davon
- Betonung von Fragmentierung, Desillusionierung und Zerstörung
- Experimentelle Schreibtechniken und Abkehr von traditionellen Erzählstrukturen
Trümmerliteratur
- Auseinandersetzung mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und der Zerstörung
- Suche nach Identität und Sinn in der Nachkriegszeit
- Verwendung von nüchternem Realismus und dokumentarischer Darstellung
Postmoderne
- Ablehnung großer Erzählungen und Meta-Narrative
- Betonung von Pluralität, Fragmentierung und Ironie
- Experimentelle Erzähltechniken und intertextuelle Bezüge
Sammlung an Gedichten
| Gedicht | Autor |
|---|---|
| Abenddämmerung | Heinrich Heine |
| Abendgebet | Achim von Arnim |
| Abendlied | Matthias Claudius |
| Abschied | Joseph von Eichendorff |
| Ach Liebste, laß uns eilen | Martin Opitz |
| Am Brunnen vor dem Tore | Willhelm Müller |
| An den Mond | Johann Wolfgang von Goethe |
| An Deutschland | Paul Fleming |
| An die Nachgeborenen | Bertolt Brecht |
| Astern | Gottfried Benn |
| Auf dem See | Johann Wolfgang von Goethe |
| Aufruf | Georg Herwegh |
| Augen in der Großstadt | Kurt Tucholsky |
| Befiehl du deine Wege | Paul Gerhardt |
| Belsatzar | Heinrich Heine |
| Bitte | Nikolaus Lenau |
| Das Fräulein stand am Meere | Heinrich Heine |
| Das Göttliche | Johann Wolfgang von Goethe |
| Das Lächeln der Mona Lisa | Kurt Tucholsky |
| Das Lied von der Glocke | Friedrich Schiller |
| Das zerbrochene Ringlein | Joseph von Eichendorff |
| Der Gott der Stadt | Georg Heym |
| Der Handschuh | Friedrich Schiller |
| Der Knabe im Moor | Annette von Droste-Hülshoff |
| Der Panther | Rainer Maria Rilke |
| Der Rattenfänger von Hameln | Achim von Arnim |
| Der Tanzbär | Gotthold Ephraim Lessing |
| Der Wald | Paul Zech |
| Der Wanderer | Friedrich Hölderlin |
| Der Wegweiser | Wilhelm Müller |
| Der Zauberlehrling | Johann Wolfgang von Goethe |
| Des Sängers Fluch | Ludwig Uhland |
| Deutschland. Ein Wintermärchen | Heinrich Heine |
| Die Beiden | Hugo von Hofmannsthal |
| Die blaue Blume | Joseph von Eichendorff |
| Die Brück' am Tay | Theodor Fontane |
| Die Bürgschaft | Friedrich Schiller |
| Die drei Spatzen | Christian Morgenstern |
| Die Fabrik | Gerrit Engelke |
| Die Fahrende | Gertrud Kolmar |
| Die Ideale | Friedrich Schiller |
| Die Gedanken sind frei | Hoffmann von Fallersleben |
| Die gestundete Zeit | Ingeborg Bachmann |
| Die Kraniche des Ibykus | Friedrich Schiller |
| Die Loreley | Heinrich Heine |
| Die schlesischen Weber | Heinrich Heine |
| Die Stadt | Theodor Storm |
| Du musst das Leben nicht verstehen | Rainer Maria Rilke |
| Die Zeit geht nicht | Gottfried Keller |
| Eine Frage | Kurt Tucholsky |
| Er ist's (Frühling) | Eduard Mörike |
| Erlkönig | Johann Wolfgang von Goethe |
| Es ist alles eitel | Andreas Gryphius |
| Fink und Frosch | Wilhelm Busch |
| Fragen eines lesenden Arbeiters | Bertolt Brecht |
| Frische Fahrt | Joseph von Eichendorff |
| Für meine Söhne | Theodor Storm |
| Grodek | Georg Trakl |
| Großstadtmorgen | Arno Holz |
| Hälfte des Lebens | Friedrich Hölderlin |
| Heidenröslein | Johann Wolfgang von Goethe |
| Hinter dem Horizont | Oskar Loerke |
| Hörst du wie die Brunnen rauschen | Clemens Brentano |
| Ich bin der Welt abhanden gekommen | Friedrich Rückert |
| Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria | Novalis |
| Ich und Du | Friedrich Hebbel |
| Im Walde | Eichendorff |
| In einer großen Stadt | Detlev von Liliencron |
| Inventur | Günter Eich |
| John Maynard | Theodor Fontane |
| Juli | Max Dauthendey |
| Kassandra | Friedrich Schiller |
| Krieg und Friede | Friedrich von Logau |
| Lied einer Schlesischen Weberin | Louise Aston |
| Lob des Winters | Johann Christian Günther |
| Mailied | Johann Wolfgang von Goethe |
| Mondnacht | Joseph von Eichendorff |
| Nachtgedanken | Heinrich Heine |
| Nähe des Geliebten | Johann Wolfgang von Goethe |
| Nur du allein | Ada Christen |
| Ode An die Freude | Friedrich Schiller |
| Osterspaziergang | Johann Wolfgang von Goethe |
| Poesie und Geschäfte | Achim von Arnim |
| Prometheus | Johann Wolfgang von Goethe |
| Rastlose Liebe | Johann Wolfgang von Goethe |
| Sachliche Romanze | Erich Kästner |
| Schlaf, Kindlein, Schlaf | Achim von Arnim |
| Sehnsucht | Joseph von Eichendorff |
| Sprich aus der Ferne | Clemens Brentano |
| Todesfuge | Paul Celan |
| Tränen des Vaterlandes | Andreas Gryphius |
| Trotz alledem! | Ferdinand Freiligrath |
| Vergänglichkeit | Hermann Hesse |
| Vergänglichkeit der Schönheit | Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau |
| Vergiss mein nicht | Novalis |
| Wanderung | Justinus Kerner |
| Wandrers Nachtlied | Johann Wolfgang von Goethe |
| Weltende | Else Lasker-Schüler |
| Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren | Novalis |
| Willkommen und Abschied | Johann Wolfgang von Goethe |
| Wünschelrute | Eichendorff |
| Zuversicht | Ludwig Tieck |
Häufig gestellte Fragen
Ein Gedicht ist eine literarische Form, die oft durch rhythmische Sprache, Metaphern, Reime und Strophenstruktur gekennzeichnet ist. Gedichte können verschiedene Themen ansprechen, Gefühle ausdrücken.
Es gibt viele verschiedene Arten von Gedichten, darunter Sonette, Haikus, Balladen, Oden, Elegien und freie Verse. Jede Art hat ihre eigenen Merkmale und Strukturen, die sie einzigartig machen.
Das lyrische Ich ist die fiktive Stimme oder Perspektive, die in einem Gedicht spricht und oft die Gefühle, Gedanken oder Erfahrungen des Dichters repräsentiert.
Ein gutes Gedicht kann viele verschiedene Dinge ausmachen, aber oft zeichnet es sich durch Originalität, emotionale Tiefe, kraftvolle Sprache und eine starke Verbindung zum Leser aus. Ein Gedicht, das Bilder und Gefühle evoziert und den Leser zum Nachdenken anregt, wird oft als erfolgreich angesehen.
Gedichte sind wichtig, weil sie eine einzigartige Möglichkeit bieten, Gefühle, Ideen und Erfahrungen auszudrücken. Sie können Trost spenden, inspirieren, informieren und die Menschheit durch die Kraft der Sprache verbinden. Gedichte sind auch ein wichtiger Teil der literarischen Tradition und können uns helfen, die Welt und uns selbst besser zu verstehen.
