
Sein erstes Wort war "nice", als ich ihm in Chicago seine Anziehsachen nach dem Mittagsschlaf zurechtlegte, lange bevor der Ausdruck zum Allerweltkommentar wurde. Mein inzwischen 24-jähriger Sohn trägt, als ich ihn in Berlin treffe, fast ins Weiße ausgewaschene Jeans mit weitem Bein, die Längen überlappen seine schwarzglänzenden Sneakers. Wenn er geht, schleift der Stoff am Pflaster und hört sich an wie das Geräusch von Hausschlapfen. Dazu einen engen Rollkragenpullover, dessen Blau ins Graue verwaschen wurde. "Trashy, aber klassisch", sagt er. Sein Haar ist diesmal länger, um die drei Zentimeter, stachelig, ein Igel mit weißgefärbten Spitzen, bei dunkleren Ansätzen. "Auf die Haarfarbe muss nun alles abgestimmt werden." Meint er. "Mit dieser Frisur wirken die Kleidungstücke anders." Wie ein mathematisches Vorzeichen, stelle ich mir vor. Seine helle Jacke ist voller Reißverschlüsse. Immer noch hängt der Bund seiner Jeans tief. Er kommt nicht davon los, sagt er. Alle Hosenbeine sind zu kurz, der Stoff sollte sich aber so halb über die Schuhe legen. Also muss er die Hosen tiefer ziehen. Mein Sohn ist inzwischen größer als ich. Und ich bin schon hochgewachsen, habe dasselbe Problem. Was ich auch versuche, meist ist da zu viel Abstand zwischen Boden und Saum.
Wir haben uns verabredet, weil ich wissen will, wie sein Style funktioniert. Schon länger leben wir nicht mehr zusammen, er wohnt nach Paris wieder in Berlin, ich inzwischen in Wien. In unsere gemeinsame Berliner Wohnung kamen oft seine Freunde zu Besuch. Eines schönen Tages tauchten die Teenager in Regenhosen aus Nylon auf. Das raschelnde, leicht quietschende Material erinnerte mich an Chicago, als wir in Skihosen durch die Großstadt watschelten, die Straßen im Winter meterhoch unter einer Schneedecke. In Berlin an den Beinen der Teenies kam mir das Geräusch wie ein Witz vor. Ich verstand diese Hosen nicht. Das Quietschrascheln, das mich so irritierte, bedeutete, dass nicht mehr ich es war, die entschied, was mein Sohn an seinem Körper trug. Ich musste den Staffelstab der Mode an ihn übergeben.

Staffelstabübergaben
Ich selbst hatte ihn von meiner Mutter erhalten, die nähte, um sich Schneidergeld zu verdienen, wie sie sagte. Die mir und meinen Brüdern so gut wie alle Kleidung anfertigte. Mit ihr focht ich als Teenager Kämpfe aus, als ich nicht mehr tragen wollte, was sie für mich entwarf. Die Bilder, die sie mit den von ihr erdachten und genähten Kleidern auf mich warf, wies ich zurück. Heftig. Tränen und Streit. Lieber besuchte ich Flohmärkte, kaufte Fetzen, wie Mutter sagte. Dann verließ ich das Elternhaus und nähte aus billigen Stoffen Modelle nach, die ich in Magazinen fand, erwarb Secondhandmode in Berlin, Fünfziger- und Sechzigerjahrekleider aus Seide.
Nachdem ich mein Studium beendet hatte, trug man in Berlin tiefsitzende weite Hosen, ausgewaschen und zerfranst, Schuhe mit Sohlen in der Dicke von Ziegelsteinen, auch die Männer, Blousons aus Ballonseide oder auch große Jacken aus Kunstleder. Und Vokuhila-Frisuren. Ich musste erst lernen, was das bedeutete. Vorn kurz, hinten lang. Nun, als ich aus der S-Bahn Warschauer Straße steige, erlebe ich ein Déjà-vu. Auf der Brücke kommen mir von Neuem derart gekleidete junge Menschen entgegen. Manche haben die Schläfenhaare blau, magenta oder grün gefärbt.
"Typisch", erklärt mein Sohn. Auch er bevorzugt Mode aus einer Zeit, als er noch nicht geboren war.
"Warum eigentlich?"
"Na, jede Generation erfindet die Zeichen und Symbole für sich neu. Bedient sich aus dem, was schon da war. Zum Beispiel die vielen Reißverschlüsse auf meiner Jacke, wie bei Punk. Außerdem kaufen wir oft Vintage."
Schon als Teenager tauschte er mit Freunden Kleidung. Ich kam nicht mehr nach, um herauszufinden, von wem oder woher diese oder jene Jacke, dieses oder jenes Shirt stammte. Manchmal kauften die Jungs günstig ein und verkauften die Stücke teurer weiter. "Aber das ist vorbei." Bemerkt mein Sohn. "Im Grunde kannst du nur mehr online kaufen. Und da schnappen dir oft Bots die besten Angebote weg. In den Vintagestores findest du keine guten Sachen mehr, und wenn, sind sie überteuert."
Meine Mutter nähte ebenfalls für meine Kinder. Am liebsten waren ihr Kostüme, wie Elefanten, Pinguine. Sie nähte Kuscheltiere, ausgestopfte Hasen, in karierte Hemden und Latzhosen gekleidet, verschob ihre Wünsche nun auf Enkel. Als mein Sohn gerade seine ersten Schritte tat, schickte sie einen Ganzkörperoverall aus braunem Filz. Die Löwenkapuze umrahmt von Fransen. Eine Mähne. Das fällt mir ein, als ich auf Instagram ein Foto von ihm finde. Er posiert in einer weißen Jacke mit Kapuze mit Kunstpelz besetzt, der dicke Flausch hängt ihm tief über den Augen. Er postet kleine weiße Pudel dazu. Style, aber mit Humor.
"Es kommt nicht darauf an, dass du von Kopf bis Fuß in edle Teile gekleidet bist", erklärt mein Sohn. "Die Accessoires machen den Look." Zum Beispiel, Brillen mit Fensterglas oder Sonnenbrillen. Er besitzt eine Sammlung davon. Den nietenverzierten Gürtel trägt er nur als Schmuck. Ein kleines rundes Ding baumelt daran, an dem man eigentlich ein Feuerzeug befestigt, um es nicht dauernd zu verlieren. Er hat stattdessen seinen Labello griffbereit. "Ein-, zweimal im Jahr fahren wir nach Lichtenberg ins vietnamesische Einkaufszentrum. Dort findest du so Kleinigkeiten, die von den Designern inspiriert sind, günstig."
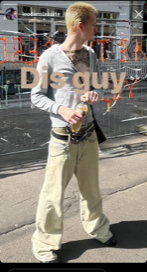
"Wenn er geht, schleift der Stoff am Pflaster und hört sich an wie das Geräusch von Hausschlapfen." Sabine Scholl will wissen, wie der Style ihres Sohnes (siehe oben) funktioniert.
Lichtenberg ist mit seinen Plattenbausiedlungen einer der uncoolsten Bezirke Berlins und bekannt für seine vietnamesische Community. Dort zeigt mir mein Sohn, was er sich in Paris hat machen lassen. Tooth-Gems, aufsteckbare Zahnhülsen aus Chrom. "Grills", wie die Rapper das schon zu Zeiten nannten, als ich noch Hip-Hop hörte. Vor der Geburt meines Sohns. Schmuckstücke, die man trägt wie einen besonderen Ring zum Ausgehen. "Sie dürfen nicht Silber sein, weil das oxidiert und wie Karies wirkt", erklärt er. Als ich ihn das erste Mal mit dem Zahnschmuck auf einem Foto sah, musste ich lauthals lachen, weil ich daran dachte, wie viele Termine wir beim Kieferchirurgen verbracht hatten, wie viele Jahre mein Sohn Zahnspangentorturen ertragen musste wegen eines schief gewachsenen Schneidezahns. Alles, um ein regelmäßiges Gebiss zu erzielen. Und dann wurde es schick, einen Aufsatz zu tragen, mit dem er aussah, als hätte er Lücken in den Zahnreihen. Ich kriegte mich nicht mehr ein.
Eigentlich hatte ich gedacht, mein Sohn würde mir ein paar Läden zeigen, die Kleider verkauften, die ihm gefielen. Letztlich besuchen wir nur drei: zuerst den Store im Soho-House. Im Café blicken Menschen angestrengt in ihre Laptops und Mobiltelefone. Auf Kleiderbügeln findet sich originelle, aber teure Kleidung, hauptsächlich für Männer. "Die hängen sicher schon über zwei Jahre unverkauft herum", meint er.
Danach suchen wir den Comme-des-Garçons-Store auf, wo ich mich gerne bedient hätte, hätte ich das Budget, nicht nur jetzt, sondern immer schon, seit es diese Marke gibt. Noch bevor ich je nach Japan kam, bewunderte ich Handwerk und Ästhetik der Designerin Rei Kawakubo, suchte den Pariser Laden auf wie eine Galerie. Mein Sohn auch. Haben wir also doch denselben Geschmack? Nun streifen wir durch die Räume, berühren Stoffe, greifen nach roten Lackbörsen mit umgedrehten Nähte, kommentieren, was uns an diesem und jenem gefällt. Zufällig kommen wir noch an einem Laden vorbei, der nur Kleidung in Grau, Weiß und Schwarz, alles zu extrem hohen Preisen, anbietet. Sogar der Mops, der sich über unseren Besuch freut, ist pechschwarz. Dazu läuft pseudoreligiöse Musik. "Eigentlich unerträglich", bemerkt mein Sohn, als wir wieder draußen sind, "online findest du bessere Sachen."

"Wo genau?"
"Vinted und Vestiaire Collective sind die professionellsten Plattformen."
Er zeigt mir Teile, die ihm gefallen, von Designern wie Helmut Lang, Martin Margiela, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood. Ich staune. Genau die mag ich auch, obwohl ich noch nie ein derartiges Stück trug. Verstehen wir uns kleidungstechnisch besser, als ich dachte? "Gaultier", sagt er noch, "die halbdurchsichtigen Tattooshirts, wenn die Muster nicht allzu verschnörkelt sind." Und mir fällt ein, wie sehr ich eine Studienkollegin aus vermögendem Hause um so ein Teil beneidete. So etwas konnte ich mir nicht selbst zusammenbasteln. Jetzt trägt mein Sohn das Vintage-Damenshirt, wie er mir auf einem Foto zeigt. Darunter aber schimmert etwas. Ich ahne Schlimmes.

Dämonisch, aber nicht satanisch
Es gab zwei Dinge, die ich meinen Kindern nicht erlaubte, Haustiere und Tätowierungen. Mit dem Ergebnis, dass beide sich sofort, nachdem sie ausgezogen waren, Katzen zulegten. Und klar, findet sich auf der Brust meines Sohnes inzwischen ein Tattoo. Was genau? Eine Zahl, zusammengesetzt aus dem Anfang der Pariser Postleitzahlen und der Vorwahl Berlins. Eine Art Identitätsausweis, zwei Sprachen, zwei Metropolen, zwei Nationalitäten. Sein bester Freund trägt dieses Zeichen ebenfalls auf der Haut. So viel zu mütterlichen Verboten. Wir sprechen über Zahlenmystik, dann zeigt er mir das Design. Es ist größer als gedacht, nicht auf den ersten Blick als Ziffer erkennbar, geschwungen, spitzig, krallenartig.
"Doch etwas dämonisch", sage ich.
"Aber nicht satanisch", entgegnet er.
"Und warum überhaupt?"
"Ein weiteres Detail, um eine individuelle Note zu erzielen. Das Blöde allerdings ist, dass du denkst, du findest und machst was völlig Unvorhergesehenes, aber dann fällt dir mit der Zeit auf, dass immer mehr Ähnliches auftaucht. Das Einzigartige vermehrt sich rasch, vor allem über die sozialen Medien. Dann scheint es schon jeder zu tragen, und man sucht nach Neuem", seufzt mein Sohn.
Bei unserem letzten Treffen machten wir ein Selfie. Die Stufen, auf denen wir sitzen, enthalten Geschichten unseres gemeinsamen Lebens. Hier hielten wir nach dem Kino, dem Sport, dem Konzert kurz an, bevor wir die Straße überquerten, wo sich unser Zuhause befand und er immer noch wohnt. Seine Sonnenbrillen, kantig, klobig, riesig, werfen Schatten auf seine Wangen. Seine Lippen setzen an zu posieren, aber ich habe bereits abgedrückt, seine Miene wirkt deshalb leicht unschlüssig. Mein Haar ist kinnlang, meine Brille rund und dunkel, meine Nase geschwungen. Sehen wir uns ähnlich? Auf diesem Foto nicht. Er hat möglicherweise eine Generation übersprungen, ist meinem Vater ähnlicher als mir. Ich schreibe: Sonniger Sohn. Poste. Nice, oder? (Sabine Scholl, 11.5.2024)